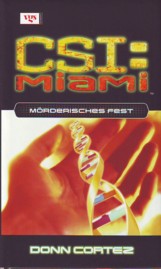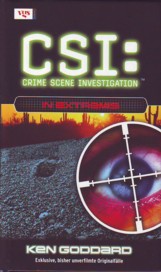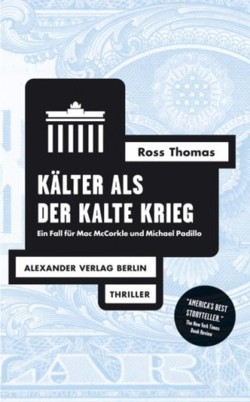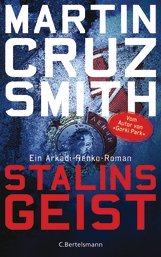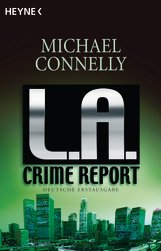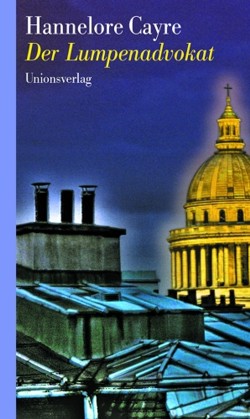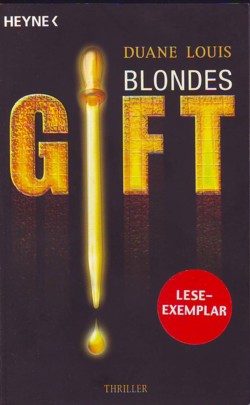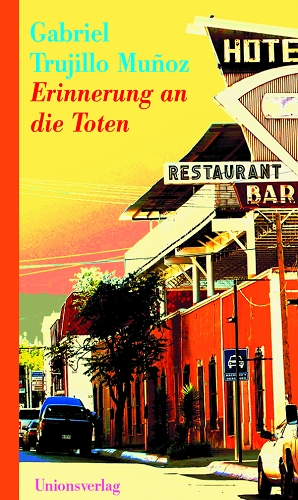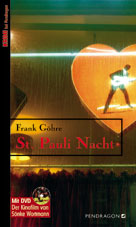Die erfolgreiche Forensik-Serie „CSI“ mit ihren beiden Ablegern muss wahrscheinlich nur Menschen vorgestellt werden, die die vergangenen Jahre auf einer einsamen Insel lebten. Doch alle anderen kennen die drei Ermittlerteams und wissen, dass diese in Las Vegas, Miami und New York mit modernsten wissenschaftlichen Methoden Täter fangen. Denn, so das Motto der Serie, Beweise lügen nicht. Nach dem Erfolg der Serie wurden Computerspiele, Comics und Romane mit neuen Fällen auf den Markt geworfen.
Auch die neuesten CSI-Romane werden den Fans in gefallen. Denn besonders die Romane „CSI: Crime Scence Investiagions – In Extremis“ von Ken Goddard (weniger gelungen) und „CSI: Miami – Mörderisches Fest“ von Donn Cortez (gelungener) folgen fast schon sklavisch genau der Struktur der Filme mit mehreren parallelen Fällen und einem Verzicht auf psychologische Erklärungen. Nur „CSI: NY – Sintflut“ von Stuart M. Kaminsky geht genauer auf die Motive der Täter ein und erzählt auch aus der Perspektive von Tätern und Opfern.

Damit ist sein dritter „CSI:NY“-Roman für normale Krimifans sicher das befriedigenste Buch. Aber mit drei parallelen Mordermittlungen ist es schwer den Überblick zwischen den Fällen und den zahlreichen Verdächtigen zu behalten. Der Hauptfall ist eine Serienkillergeschichte. In ihm will ein Killer in einer Nacht mehrere Menschen umbringen. Mac Taylor entdeckt auf dem Körper der Ermordeten eingeritzte Buchstaben. Sie scheinen ein Hinweis auf den Täter, sein Motiv und seine künftigen Morde zu sein. Taylor fragt sich, wie viele Menschen noch auf der Liste des Killers stehen.
Der zweite Fall, der bestialische Mord an dem beliebten Lehrer Alvin Havels in einer Nobelschule, ist ein klassisches Locked-Room-Mystery. Der Lehrer wurde in seinem Klassenzimmer ermordet. Der Gang vor dem Zimmer wird mit Videokameras überwacht. Der Kollege, der die Leiche entdeckte, hat niemanden gesehen. Danny Messer und Lindsay Monroe fragen sich: Wie konnte der Täter also den Tatort verlassen?
Der dritte Fall sorgt für den nötigen Humor. Eine Bombe zerstört eine Wirtschaft. Ermittler Sheldon Hawkes wird in dem einsturzgefährdeten Haus in einem Loch verschüttet. Bei ihm ist ein Mann, der sich Connor Custus nennt und wahrscheinlich für die Explosion verantwortlich ist. In jedem Fall hat er ein abenteuerliches Leben hinter sich hat und ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Von oben versuchen Stella Bonasera und die Feuerwehr die beiden Eingeschlossenen zu befreien. Wegen des sintflutartigen Regens, der auch alle Spuren vernichtet, haben sie nicht viel Zeit.
Stuart M. Kaminsky führt die Fälle zu einer befriedigenden Lösung. Außerdem gelingt es ihm, die verschiedenen Charaktere mit wenigen Worten zu skizzieren. So sind die Verhöre der Schülerinnen hübsche kleine Charakterstudien. Und, nachdem New York in „Der Tote ohne Gesicht“ (Dead of winter, 2005) unter einer Kältewelle, in „Blutige Spur“ (Blood on the sun, 2006) unter einer Hitzewelle, litt, regnet es in „Sintflut“ bereits seit Tagen ohne Unterbrechung. Selbstverständlich beeinflusst das ungewöhnliche Wetter wie in den vorherigen „CSI:NY“-Romanen von Stuart M. Kaminsky die Ermittlungen.
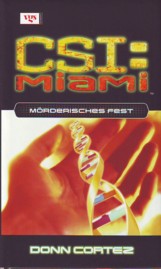
Auch Donn Cortez präsentiert in seinem CSI:Miami“-Roman „Mörderisches Fest“ drei Fälle. Aber im Gegensatz zu Stuart M. Kaminsky legt er den Schwerpunkt – wie die TV-Serie – auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Ermittlungsschritte.
Die Vorweihnachtstage unterscheiden sich in Miami, bis auf die Temperatur, nicht so sehr von deutschen Vorweihnachtstagen. Wildgewordene Weihnachtsmänner toben durch die Stadt, hinterlassen ihre Spuren und betrinken sich bei der Santarchy. Als einer von ihnen stirbt, müssen die CSIler ran. Schnell finden sie heraus, dass der arbeitslose Schauspieler Kingsley Patrick vergiftet wurde. Ryan Wolfe und Frank Tripp müssen als verantwortliche Ermittler herauszufinden, ob der Mörder wirklich diesen Santa umbringen wollte. Denn Patrick führte ein zurückgezogenes Leben und er hatte keine Feinde.
Der zweite Fall dreht sich um einen Mann, der in den Sümpfen gefunden wurde. Sein Kopf ist explodiert. Eine harte Nuss für Eric Delko. Denn am Tatort gibt es keine Spuren von dem Mörder. Und er muss zuerst die Identität des aus Südamerika kommenden John Doe, der wahrscheinlich Rauschgift schmuggelte, herausfinden.
Der dritte Fall ist anfangs der komödiantische Fall. Der Zauberer Abdus Sattar Pathan verprügelt einen Kioskbesitzer. Anscheinend haben ihn die Nacktaufnahmen einer Muslima in Rage versetzt. Horatio Caine wird in den Fall verwickelt, weil Pathan sich weigert, sich seine Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. Als er später kooperiert und die Tat leugnet, glaubt Caine, dass er hereingelegt werden soll. Noch bevor Caine herausfindet, wie Pathan die Beweise manipulierte, wird Pathan entführt. Oder ist das ein weiterer Trick des Zauberers?
Im Gegensatz zu den beiden anderen Fällen wird der Pathan-Fall nicht richtig gelöst. Zwar wird Pathan am Ende verhaftet, aber Cortez erzählt nicht, wie er die Beweise so manipulierte, dass Caine es nicht herausfinden konnte. Allerdings beruht die CSI-Formel genau darauf, dass der Tathergang anhand von Spuren erklärt wird. Und weil Caine in diesem Fall ermittelte, war es der Hauptfall, der dann auch vollständig geklärt werden sollte.
Die Pathan-Gesichte ist der Cliffhanger zum nächsten CSI:Miami-Roman „Harm for the Holidays – Heart Attack“ (2007) von Donn Cortez.
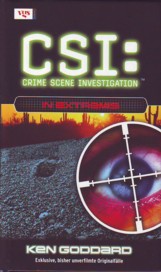
Ken Goddards erster „CSI“-Roman „In Extremis“ mit dem Las-Vegas-Team unterscheidet sich, allerdings nicht zu seinem Vorteil, von den „CSI“-Romanen von Stuart M. Kaminsky und Donn Cortez. Bei Goddard steht ein Fall im Mittelpunkt und, ein Tabubruch im „CSI“-Universum, im ersten Kapitel schildert Goddard den Tathergang.
Der psychopathische Ex-Soldat Alek Mialkovsky soll einen Mord verüben. Mitten in der Nacht liegt er am Treffpunkt in der Wüste auf der Lauer. Zufällig trifft eine Gruppe von Bikern ein. Die sorgfältig geplante Operation läuft aus dem Ruder und die Biker erschießen einen Pick-up-Fahrer.
Kurz darauf ruft Captain Jim Brass Gil Grissom und sein gesamtes Team zum Tatort. Denn die Biker sind Undercover-Polizisten, die einen wichtigen Drogendealer auf frischer Tat verhaften wollten. Die Forensiker beginnen den Schusswechsel zu rekonstruieren. Da wird auf einer nahe gelegenen Lichtung eine weitere Leiche entdeckt. Mialkovsky beobachtet mit dem Gewehr im Anschlag die Ermittler. Und ein Sturm naht.
Gerade weil Ken Goddard penibel der kondensierten „CSI“-Formel folgt, zeigt er auch, dass das in Buchform zu wenig ist. In ihr wird, ähnlich einem Whodunit, der Ablauf eines Verbrechens rekonstruiert. Aber „In Extremis“ ist, schließlich ist der Mörder von Anfang an bekannt, kein Whodunit. Es ist nur die Rekonstruktion eines uns bekannten Tatverlaufs. Weil Goddard aber nicht erklärt, warum sich zufällig ein Dutzend Menschen mitten in der Nacht in der Wüste treffen und er auch keine Hinweise auf Mialovskys Auftraggeber und Auftrag gibt, werden die Morde immer mehr zu einem beliebigen, nicht sonderlich spannendem, forensischen Rätsel. Das Ende, in dem der Mörder ungestraft entkommen kann, beschließt einen schlechten CSI-Roman. Oder sagen wir es umgekehrt: „In Extremis“ wäre, mit einem anderen Anfang, eine okaye „CSI“-Folge.
Insgesamt hat Stuart M. Kaminsky mit „CSI:NY – Sintflut“ das für Krimifans beste CSI-Buch des Herbstes geschrieben. Donn Cortez spekuliert mit dem Ende von „CSI: Miami – Mörderisches Fest“ zu unverholen auf eine Fortsetzung. Allerdings hat er auch zwei gute Kriminalfälle geschrieben. Es ist damit ein Buch, das sich vor allem an „CSI:Miami“-Fans richtet. Ken Goddards CSI-Einstand „In Extremis“ ist als reine Tatrekonstruktion auch für CSI-Fans enttäuschend.
Stuart M. Kaminsky: CSI: NY – Sintflut
(übersetzt von Antje Görnig)
VGS, 2007
312 Seiten
17,95 Euro
Originalausgabe:
CSI: NY – Deluge
Pocket Books, 2007
Donn Cortez: CSI: Miami – Mörderisches Fest
(übersetzt von Frauke Meier)
VGS, 2007
312 Seiten
17,95 Euro
Originalausgabe:
CSI: Miami – Harm for the Holidays – Misgivings
Pocket Books, 2006
Ken Goddard: CSI: Crime Scence Investigations – In Extremis
(übersetzt von Frauke Meier)
VGS, 2007
280 Seiten
17,95 Euro
Originalausgabe:
CSI: Crime Scence Investigation – In Extremis
Pocket Books, 2007
Hinweise:
Homepage von Stuart M. Kaminsky
Homepage von Donn Cortez
Homepage von Ken Goddard
Meine Besprechung von Stuart M. Kaminsky: CSI:NY – Der Tote ohne Gesicht
Meine Besprechung von Stuart M. Kaminsky: CSI:NY – Blutige Spur
Meine Besprechung von Max Allan Collins: CSI – Im Profil des Todes
Meine Besprechung von Kris Oprisko/Jeff Mariotte: CSI:Miami (Comic)
Meine Besprechung von Kris Oprisko: CSI – Domino (Comic)
Meine Besprechung von Steven Grant: CSI – Geheimidentität (Comic)
Meine Besprechung von Max Allan Collins: CSI:NY – Blutiger Mord (Comic)
Meine Besprechung von Max Allan Collins: CSI – Das Dämonenhaus
(weil es bei allen Besprechungen auch zahlreiche Links zu verschiedenen CSI-Seiten gibt, verzichte ich hier darauf)
Gefällt mir Wird geladen …
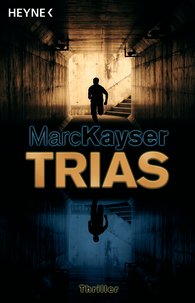



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB