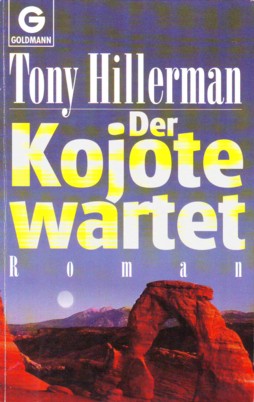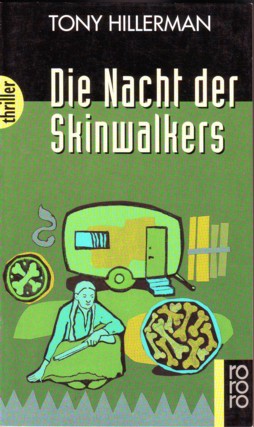Für „Driver“ erhielt James Sallis den Deutschen Krimipreis, war Jahressieger der KrimiWelt-Bestenliste, sammelte euphorische Kritiken und auch den Lesern gefiel der schmale Band über einen Stuntman und Fluchtwagenfahrer, der in eine böse Geschichte hineingerät und alle seine Prinzipien zur Disposition stellen muss.
Der vor wenigen Wochen erschienene Roman „Deine Augen hat der Tod“ erschien bereits 1999 in der kurzlebigen Dumont-Noir-Reihe und ist eine sperrige Mischung aus Agententhriller und Road-Movie. In ihm muss Ex-Agent David sein beschauliches Leben hinter sich lassen und einen Kameraden suchen, der mordend durch Amerika zieht.
Bei Dumont erschienen auch die ersten beiden Lew-Griffin-Romane „Die langbeinige Fliege“ (The Long-Legged Fly, 1992) und „Nachtfalter“ (Moth, 1993). Griffin ist Privatdetektiv, Professor, Dichter, Blues-Fan, Autor, Alkoholiker und Afroamerikaner. In New Orleans ist das keine erfolgversprechende Mischung. Nach sechs Bänden beendete Sallis die hochgelobte Lew-Griffin-Serie und startete 2003 eine inzwischen aus drei, noch nicht übersetzten, Bänden bestehende Serie mit John Turner. Auch er ist als Ex-Polizist, Ex-Betrüger, Ex-Therapeut und, ab dem zweiten Band, Deputy Sheriff in einer Kleinstadt in der Nähe von Memphis, Tennessee, ein vielschichtiger Charakter. Die Geschichten mit Griffin und Turner sind, im Gegensatz zu den Einzelwerken „Driver“ und „Deine Augen hat der Tod“, tief in den Südstaaten verwurzelt. Vergleiche mit James Lee Burke und seinem Helden Dave Robicheaux liegen nahe und sind auch gar nicht so verkehrt.
Bevor James Sallis unter die Krimiautoren ging, schrieb er mehrere Bücher über Jazzgitarristen, Biographien und Essays über Samuel R. Delany, Chester Himes, Jim Thompson und David Goodis, übersetzte Raymond Queneau und war, als Science-Fiction-Fan, in den Sechzigern Redakteur des avantgardistischen britischen Science-Fiction-Magains „New World“.
Musikalisch ausgedrückt sind die Einzelwerke von James Sallis Cool Jazz und die Serien Blues. Beide Male spielt er souverän mit bekannten Formen. Bei den Lesungen wird es daher literarischen Cool Jazz geben. Den Sallis-Blues wird Liebeskind in den nächsten Jahren veröffentlichen.
–
Die Tournee:
Sonntag, 2. November, 11:00 bis 13:00 Uhr
Katholische Akademie Schwerte
“Mord am Hellweg“
Bergerhofweg 24 – 58239 Schwerte
Moderation: Ekkehard Knörer
Eintritt: VVK 7/5 €; TK 10/8 €
Karten: Ruhrtal-Buchhandlung 02304 / 18 0 40
–
Montag, 3. November, 20:00 Uhr
Stage Club in der Neuen Flora
„Krimifestival Hamburg“
Stresemannstraße 163 – 22769 Hamburg
Moderation: Denis Scheck
Deutsche Textlesung: Mechthild Großmann
Eintritt: 10 €
Karten: Buchhandlung Heymann 480 93-0 / Abendblatt-Ticket-Hotline 30 30 98 98
–
Dienstag, 4. November, 20:00 Uhr
Literaturhaus Stuttgart
Breitscheidstraße 4 – 70174 Stuttgart
Moderation: Denis Scheck
Deutsche. Textlesung: Rudolf Guckelsberger
Eintritt: 8,- € / 6,- €
Karten: Buchhandlung im Literaturhaus, 28 42 90 4
–
Mittwoch, 5. November, 20:00 Uhr
Ampere / Muffatwerk, München
Zellstraße 4, 81667 München
Moderation/Deutsche. Textlesung: Hans Jürgen Stockerl
Eintritt: VVK 6,- € / Abendkasse 8,- €
Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und München Ticket, 54 81 81 81
Kooperation: Krimibuchhandlung Glatteis
–
Donnerstag, 6. November, 20:00 Uhr
Valentin Gasthaus Am Südstern, Berlin
Körtestraße 21 / 10967 Berlin
Moderation Thomas Wörtche
Deutsche Textlesung: Karsten Weinert
In Kooperation mit der Krimibuchhandlung Hammett
Eintritt: € 5 / € 4
Karten bei Hammett 691 58 34
–
Die derzeit auf Deutsch erhältlichen Werke:
James Sallis: Deine Augen hat der Tod
(Death will have your eyes, 1997)
Aus dem Englischen von Bernd W. Holzrichter
Liebeskind, München 2008 (Neuausgabe)
192 Seiten
16,90 Euro
–
James Sallis: Driver
(Drive, 2005)
Aus dem Englischen von Jürgen Bürger
Liebeskind, München 2007
160 Seiten
16,90 Euro
–
Hinweise
Meine Besprechung von “Driver” (Drive, 2005)
(Das ist der erste Teil eines sechsteiligen Gesprächs mit James Sallis)




 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB