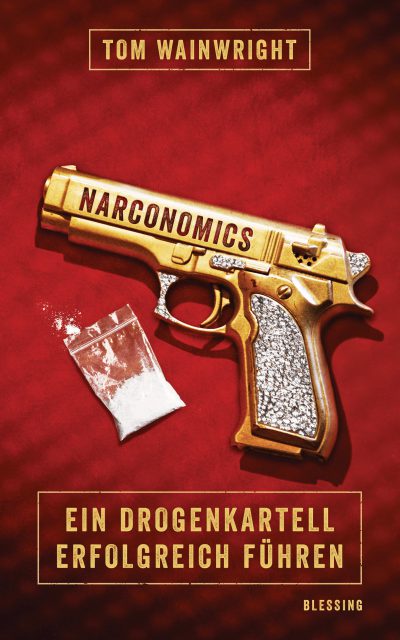Einen Film will Woody Allen noch drehen. Das sagte der 86-jährige im Juni in einem Gespräch mit Alec Baldwin. Die Dreharbeiten für diesen Film beginnen im Herbst in Paris. Ob er danach noch weitere Filme drehe, wisse er nicht. Das Umfeld für seine Filme habe sich zu sehr verändert. Früher liefen sie überall. Jetzt würden sie wenige Wochen nach dem Kinostart auf einem Streamingportal gezeigt. So hatte sein bislang letzter Film am 18. September 2020 beim Filmfestival San Sebastián seine Premiere. In den USA wurde er Anfang des Jahres nur in wenigen Kinos gezeigt. Auch in Deutschland läuft er erst jetzt in einer überschaubaren Zahl von Kinos an. Dabei ist sein 49. Film gar nicht sein schlechtester. Es ist eine Komödie, die sich nahtlos in sein durchwachsenes, oft enttäuschendes Spätwerk einfügt.
Dieses Mal geht es um Mort Rifkin (Wallace Shawn). Der snobistische Filmkritiker und Universitätslehrer begleitet seine Frau Sue (Gina Gershon) nach Spanien zum Filmfestival in San Sebastián. Sie macht dort die Pressebetreuung für Philippe (Louis Garrel). Er ist ein junger, gut aussehender, charismatischer Regisseur, der gerade im Minutentakt Preise erhält. Rifkin hält nichts von Philippes Filmen. Er schlendert durch San Sebastián. Er fragt sich, ob Sue ihn mit Philippe betrügt. Er hat Schmerzen in der Brust. Er besucht Dr. Jo Rojas (Elena Anaya) und ist, weil er aufgrund des Namens einen Mann erwartet hat, ganz erstaunt, dass Rojas eine gut aussehende, unglücklich verheiratete Ärztin ist, mit der er sich gleich sehr gut versteht. In New York wohnten sie im gleichen Viertel. Sie haben den gleichen Kunstgeschmack. Er verliebt sich in sie – und erfindet schnell neue Beschwerden um sie wieder zu besuchen.
Vor, während und nach den Dreharbeiten wurde vor allem über Woody Allens Privatleben gesprochen. Es ging, wieder einmal, um inzwischen jahrzehntealte Missbrauchsvorwürfe von seiner Ex-Frau Mia Farrow. Diese Geschichte führte auch dazu, dass sich im Rahmen der #MeToo-Debatte etliche Schauspieler und sein Produktionspartner Amazon Studio von Allen distanzierten. Die Auswertung von seinen letzten beiden Filmen, „A rainy day in New York“ und „Rifkin’s Festival“, litt auch darunter. Und dann kam die Corona-Pandemie, die zu monatelangen Kinoschließungen führte. Insofern können wir uns freuen, dass Woody Allens immer noch neuester Film in die Kinos kommt. Auch wenn es nur ein kleiner Start ist. Hier in Berlin läuft der Film in drei Kinos.
Dabei ist der Film gar nicht so schlecht. Er hält ziemlich genau das Niveau seiner vorherigen Filme. Nichts ist neu. Vieles ist sehr vertraut. Einiges fast schon lieblos und schlampig inszeniert. Die Idee, Mort Rifkins Träume mit nachgespielten SW-Szenen aus seinen Lieblingsfilmen zu illustrieren, erfreut das Herz des Cineasten.
Beim Lesen der Handlung erkennen Allen-Fans sofort viele vertraute Elemente. Beim Ansehen dürften sie für fast jede Szene mindestens eine ähnliche Szene aus einem älteren Allen-Film nennen können. „Rifkin’s Festival“ ist, wieder einmal, eine Liebeskomödie, in der beide Ehepartner mit einem Seitensprung liebäugeln. Mort Rifkin ist natürlich eine weitere Version von Woody Allen, wie wir ihn spätestens seit dem „Stadtneurotiker“ kennen. Nur dass er dieses Mal nicht von Woody Allen, sondern von Wallace Shawn gespielt wird. Und Shawn spielt ihn äußerst bedächtig und erstaunlich uninteressiert an Pointen.
Seine Lieblingsfilme sind, wenig überraschend für einen älteren Filmkritiker, vor allem Klassiker des europäischen Kinos. Inszeniert wurden diese Filme von Regisseuren, die Allen selbst bewundert. Nämlich, – in der Klammer stehen die Filme, von denen Rifkin träumt -, Orson Welles (Citizen Kane, 1941), Jean-Luc Godard (Außer Atem, 1960), François Truffaut (Jules and Jim, 1962), Luis Buñuel (Der Würgeengel, 1962), Federico Fellini (8½, 1963), Claude Lelouch (Ein Mann und eine Frau, 1966) und, wenig verwunderlich nachdem Allen eine Bergman-Phase hatte, Ingmar Bergman (Das siebente Siegel, 1957; Wilde Erdbeeren, 1957; Persona; 1966).
„Rifkin’s Festival“ ist kein Film, mit dem Allen neue Fans gewinnen wird. Es ist auch keiner seiner besten Filme. Es handelt sich eher um den Besuch eines alten Freundes, der noch einmal seine bekannten Geschichten und Witze erzählt. Wegen der vielen filmischen Anspielungen hat es auch etwas von einem Alterswerk, das noch einmal bekannte Themen, Motive und Obsessionen bündelt. Nicht um sie irgendwie neu zu bewerten, sondern um sie einfach noch einmal anzusehen. Das ist, wie sein vorheriger Film „A rainy day in New York“, schon sympathisch anspruchslos. „Rifkin’s Festival“ ist der etwas fahrige Bericht von Rifkin gegenüber seinem Therapeuten, der am Filmanfang und -ende im Bild ist, über seine Woche im sonnigen San Sebastián.
Und natürlich kann man Rifkins Träume zum Anlass nehmen, sich die ihnen zugrunde liegenden Filme wieder anzusehen. Es gibt wahrlich schlechtere Beschäftigungen für ein langes Wochenende.

Rifkin’s Festival (Rifkin’s Festival, USA 2020)
Regie: Woody Allen
Drehbuch: Woody Allen
mit Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi López, Christoph Waltz, Tammy Blanchard, Steve Guttenberg, Richard Kind, Douglas McGrath
Länge: 92 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Hinweise
Moviepilot über „Rifkin’s Festival“
Metacritic über „Rifkin’s Festival“
Rotten Tomatoes über „Rifkin’s Festival“
Wikipedia über „Rifkin’s Festival“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Woody Allens “To Rome with Love” (To Rome with Love, USA/Italien 2012)
Meine Besprechung von Woody Allens “Blue Jasmine” (Blue Jasmine, USA 2013)
Meine Besprechung von Woody Allens “Magic in the Moonlight” (Magic in the Moonlight, USA 2014)
Meine Besprechung von John Turturros “Plötzlich Gigolo” (Fading Gigolo, USA 2013 – mit Woody Allen)
Meine Besprechung von Woody Allens „Irrational Man“ (Irrational Man, USA 2015)
Meine Besprechung von Woody Allens „Café Society“ (Café Society, USA 2016)
Meine Besprechung von Woody Allens „Wonder Wheel“ (Wonder Wheel, USA 2017)
Meine Besprechung von Woody Allens „A rainy Day in New York“ (A rainy Day in New York, USA 2019)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB