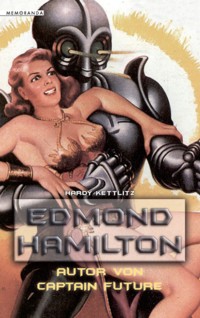Vor einigen Tagen habe ich über Bücher, die man nicht lesen kann, geschrieben.
Heute schreibe ich über ein Buch, in dem man nicht Blättern sollte: „Die Hugo Awards 1953 – 1984“ von Hardy Kettlitz.
Science-Fiction-Fans werden jetzt schon in ein kundiges Nicken verfallen. Mit einem leichten Lächeln. Denn der Hugo Award ist einer der wichtigen Science-Fiction-Preise. Seit 1953 wird er jährlich auf der World-SF-Convention von Science-Fiction-Fans für die besten Science-Fiction-Werke des Vorjahres und für besondere Verdienste um das Genre verliehen. Im Zentrum der Preise stehen Romane und, in verschiedenen Kategorien, kürzere Werke. Es werden auch Sachbücher, Filme, Comics, Illustratoren und Fans und ihre Produkte, also Semiprozines, Fanzines, Fancasts (Audio und Video), Fan Writer und Fan Artists (die Definitionen der verschiedenen Kategorien sind mehr oder weniger offen) ausgezeichnet. Und, bei Bedarf, gibt es noch Sonderpreise für besondere Leistungen. Das etwas komplizierte Abstimmungsprozedere und wer über was abstimmen darf, wird auf den ersten Seiten von „Die Hugo Awards 1953 – 1984“ von John Clute, Peter Nicholls und Hardy Kettlitz kurz erklärt. Im Endeffekt sind es die Besucher der Worldcon.
Der Hauptteil von „Die Hugo Awards 1953 – 1984“ (die späteren Jahre werden dann in einem zweiten Buch behandelt) gehört den einzelnen Gewinnern, die chronologisch nach den Hugo-Jahren aufgeführt werden. Hardy Kettlitz stellt sie in kurzen Beiträgen vor. Die Romane werden meist auf zwei Seiten, die Novellen und Kurzgeschichten auf einer Seite besprochen. Die anderen Preisträger kriegen entsprechend weniger Platz. Zahlreiche Illustrationen, normalerweise die Heft- und Buchcover (jeweils bis zu drei Bilder), runden den positiven Gesamteindruck ab. Das lädt erstens zum Blättern ein und zweitens weckt es Begehrlickeiten nach den ausgezeichneten Werken, von denen viele in eine gutsortierte Science-Fiction-Sammlung gehören und langjährige Science-Fiction-Leser auch schon gelesen haben, wie „Demolition“ (The Demolished Man) von Alfred Bester, dem ersten Hugo-Gewinner, „Der Gewissensfall“ (A Case of Conscience) von James Blish, „Sternenkrieger“ (Starship Troopers) von Robert A. Heinlein, „Lobgesang auf Leibowitz“ (A Canticle for Leibowitz) von Walter M. Miller jr., „Das Orakel vom Berge“ (The Man in the High Castle) von Philip K. Dick, „Der Wüstenplanet“ (Dune) von Frank Herbert, „Der ewige Krieg“ (The Forever War) von Joe Haldeman und „Gateway“ (Gateway) von Frederick Pohl. Um nur einige Romane zu nennen, die vor 1984 mit dem Hugo ausgezeichnet wurden.
Während Kettlitz die mehr oder weniger langen Geschichten – es werden Romane, Novellas, Novelettes und Kurzgeschichten ausgezeichnet – und die Filme kritisch würdigt und auch über deren damalige und heutige Bedeutung schreibt, konzentriert er sich bei den anderen Kategorien eher auf die biographischen und bibliographischen Fakten, in denen dann ein Bild vom Reichtum der Science-Fiction-Gemeinde entsteht. Denn es geht um Zeichner von Buchcovern und manchmal auch Illustratoren von Heften, Autoren von wissenchaftlichen Artikeln, Herausgeber und Fans, die mit ihrem Engagement Veranstaltungen organisierten und Fanzines herausgaben. Das sind Namen, die hier in Deutschland unbekannt sind, aber ohne die die Science-Fiction-Welt anders aussähe.
Hardy Kettlitz war viele Jahre Chefredakteur von „Alien Contact“ und ist Herausgeber von „SF Personality“, einer seit über zwanzig Jahren bestehenden Buchreihe über wichtige Science-Fiction-Autoren, und, seit einigen Monaten, bei Golkonda, von „Memoranda“.
Das von ihm geschriebene Sekundärwerk „Die Hugo Awards 1953 – 1984“ ist empfehlenswert und vorbildlich in jeder Beziehung. Mit der fatalen Nebenwirkung, dass man schon beim Durchblättern des Buches und dem Lesen der kurzen Texte eine unglaubliche Lust auf die vorgestellten Science-Fiction-Geschichten bekommt.
Daher wünsche ich nach der Lektüre viel Spaß beim Stöbern in den Antiquariaten, die ja auch eine gewisse Zeitreise beinhalten.
–
Hardy Kettlitz: Die Hugo Awards 1953 – 1984
Golkonda/Memoranda, 2015
320 Seiten
18,90 Euro
–
Hinweise
Golkonda über Hardy Kettlitz
Net-Home des Hugo Award
Wikipedia über den Hugo Award (deutsch, englisch)
–
Die sympathische und überhaupt nicht spacige Buchhandlung Otherland (Bergmannstraße 25, 10961 Berlin) lädt zu einer abendfüllende Signierstunde mit Hardy Kettlitz ein:
Die Veranstaltung, die uns zum überstürzten Sondernewsletter-Schreiben treibt, findet diesen Freitag, am 10. April um 19:30 unter dem schönen Motto Fan/Pro (Fan und Profi) statt. Wir haben Werner Fuchs und Hardy Kettlitz zu Gast. Sie beide verbindet die Liebe zur SF und Fantasy. Im Otherland werden sie sich darüber unterhalten, wie es ist, als Fan und Profi mit SF und Fantasy zu tun zu haben …
Werner Fuchs ist ein Urgestein der deutschen Szene, arbeitet seit den 70er-Jahren als Herausgeber, Übersetzer und Literaturagent, war für die Programme von Fischer Orbit und Knaur SF verantwortlich, ist Koautor diverser Lexika, war als einer der Gründer von Fantasy Productions maßgeblich am erfolgreichsten deutschen Rollenspiel Das Schwarze Auge beteiligt, hat unzählige Conventions besucht und sammelt SF Magazine. Hardy Kettlitz war lange Zeit Chefredakteur des Magazins Alien Contact und verfasst seit 1994 die Buchreihe “SF Personality”. Kürzlich erschien bei Golkonda sein Buch Die Hugo Awards 1953-1984. Wenn diese zwei Spezialisten zusammentreffen, kann man davon ausgehen, dass eine kritische Masse an Fachwissen, Begeisterung und Anekdoten erreicht wird!
Der Eintritt ist wie immer frei; die Veranstaltung beginnt um 19.30.
Gefällt mir Wird geladen …



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB