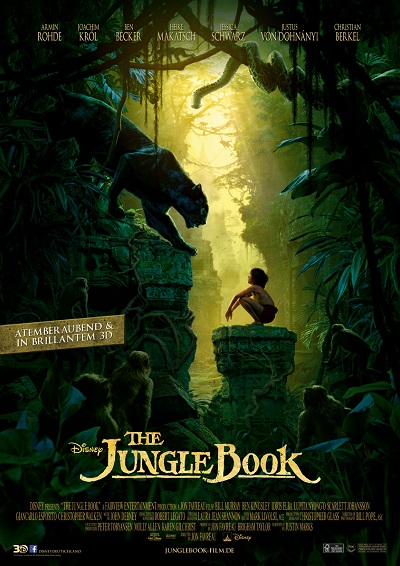Eine UFA-Fiction-Produktion in Zusammenarbeit mit RTL; mit Til Schweiger in einer wichtigen Rolle. Das weckt bestimmte Erwartungen. Auch die Synopse ändert nichts daran.
Steffi Pape (Sinje Irslinger) hat gerade ihren Realschulabschluss in der Tasche. Die Sechzehnjährige hat das Leben vor sich, wozu der erste Sex mit ihrem Freund (in Paris in einem romantischen Hotelzimmer während einer Klassenfahrt) und der erste Job (sie freut sich wie Bolle auf ihre Arbeit als Polizistin) gehören. Da erfährt sie, dass sie Krebs hat und wahrscheinlich an Weihnachten tot ist.
Ihre Mutter Eva (Heike Makatsch) möchte am Liebsten sofort mit der mütterlichen Rundumversorgung beginnen und ihre Tochter in die Chemotherapie schicken. Ihr Vater Frank (Til Schweiger) ist da entspannter, aber auch ratloser und passiver.
Als Steffi den selbstmordgefährdeten Zirkusartisten Steve (Max Hubacher) kennen lernt, entschließen sie sich, gemeinsam nach Paris zu fahren. Mit wenig Geld in der Tasche und so viel Unverständnis gegeneinander, dass der kundige Zuschauer die nächsten Stationen des Dramas schon ahnt.
Da hilft auch nicht der Authentizität heischende Hinweis, dass „Gott, du kannst ein Arsch sein“ auf einer wahren Geschichte beruht, die Steffis Vater Frank Pape nach ihrem Tod aufschrieb. In der episodischen, sich weit von der Buchvorlage entfernenden Verfilmung reiht sich ein Klischee an das nächste und, immerhin reden wir hier von einer RTL-Produktion, bleibt alles an der hübsch anzusehenden Oberfläche. Mit etlichen Merkwürdigkeiten, die in der Realität vielleicht störend, in der TV-Parallelwelt normal sind: so macht Steffis Klasse ihre Abschlussfahrt nach der Abschlussfeier. So schenkt Vater Frank seiner Tochter einen Pickup zum Schulabschluss. Dass sie in dem Moment noch lange nicht volljährig ist und den Wagen höchstens auf dem selbstverständlich malerisch abgelegenem, großen Hof fahren darf: Geschenkt.
Regisseur André Erkau vermeidet in seinem neuen Film alle möglichen Tiefen des Themas. Stattdessen gibt es zwei parallel erzählte Roadmovies. In dem einem fährt Steve Steffi nach Paris. In dem anderen verfolgen Steffis Eltern die beiden, erfahren dabei von einigen Eskapaden ihrer Tochter und benehmen sich wie ein gut eingespieltes Comedy-Paar. Das sorgt selbstverständlich für einige vergnügliche Momente, wenn Frank sich nicht an die Nummer seiner Kreditkarte erinnert oder wenn sie Steffi und Steve im Hotel (selbstverständlich in der teuren Hochzeitssuite) erwischen, aber thematische Vertiefungen gehen anders.
Dabei hätte es in der Geschichte durchaus Ansätze gegeben, die dann nicht weiter beachtet wurden. So ist Frank Pape Pfarrer. Für die Filmgeschichte ist das allerdings vollkommen unwichtig. Dieser Beruf und die damit verbundene Auffassung vom Leben hätte einen Schlüssel geboten, um über den Sinn des Lebens und ob das Leben gerecht ist, zu erzählen. Es hätte auch dazu geführt, dass der Spruch „Gott, du kannst ein Arsch sein!“ mehr als nur ein larmoyantes Tattoo auf Steffis Brust und eine damit verbundene Provokation an ihren überaus liebevollen und knuddeligen Vater wäre.
Die Tätowierung markiert das Ende einer Nacht, die Steffi mit Tammy (Jasmin Gerat), einer allein auf einem Dorf lebenden, tätowierten Kellnerin, verbringt. Tammy ist auch für die Lebensweisheit des Films, die von den Indianern kommenden vier Stufen der Liebe, zuständig.
So bleibt nach knapp hundert Filmminuten Kitsch für Teenager lediglich eine „Lebe das Leben“-Botschaft in schönster Hochglanz-Werbefilmoptik. Aber wer hat von einem RTL-Film ernsthaft etwas anderes erwartet?

Gott, du kannst ein Arsch sein! (Deutschland 2020)
Regie: André Erkau
Drehbuch: Tommy Wosch, Katja Kittendorf
LV: Frank Pape: Gott, du kannst ein Arsch sein!, 2016
Mit Sinje Irslinger, Max Hubacher, Til Schweiger, Heike Makatsch, Nuala Bauch, Jonas Holdenrieder, Benno Fürmann, Jürgen Vogel, Jasmin Gerat, Dietmar Bär, Inka Friedrich
Länge: 98 Minuten
FSK: ab 6 Jahre
–
Hinweise
Filmportal über „Gott, du kannst ein Arsch sein!“
Moviepilot über „Gott, du kannst ein Arsch sein!“
Meine Besprechung von André Erkaus „Arschkalt“ (Deutschland 2011)
Meine Besprechung von André Erkaus „Das Leben ist nichts für Feiglinge“ (Deutschland 2012)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB