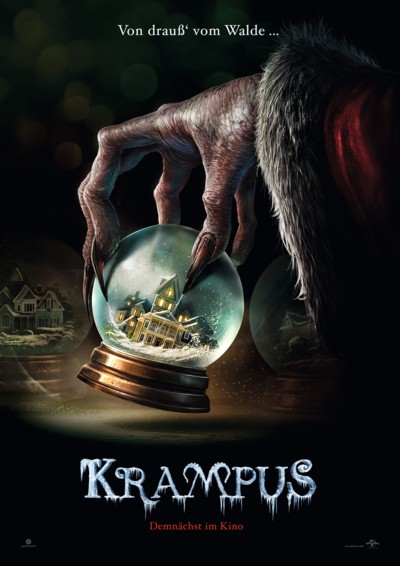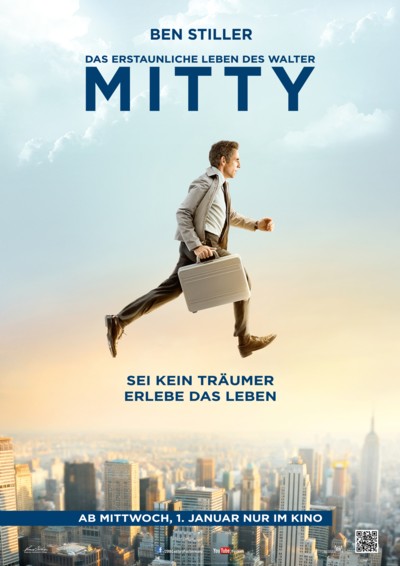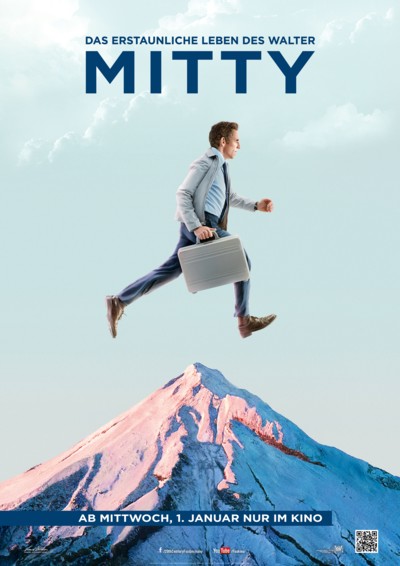Heute endet der kleine Lauf von neuen Filmen mit Sydney Sweeney. Nach der launigen RomCom „Wo die Lüge hinfällt“ und dem auf Fakten basierendem Drama „Reality“ spielt sie jetzt in einem Superheldenfilm mit. „Madame Web“ heißt das Werk. Es ist der neueste Film im Sony’s Spider-Man Universe und sie spielt Julia Cornwall. Eine Schülerin irgendwo im Teenageralter. Nach den beiden eben erwähnten Filmen, in denen sie, ihrem Alter entsprechend, Mitt-/Endzwanziger spielte, wird hier vom Zuschauer schon eine ordentliche Portion suspension of disbelief verlangt. Da helfen auch die betont unattraktive Schuluniform und die riesige Bücherwurm-Brille nur bedingt. Aber sie hat nur eine Nebenrolle.
Im Zentrum steht Cassandra ‚Cassie‘ Webb (Dakota Johnson), die titelgebende Madame Web. Am Filmanfang ist sie eine dreißigjährige Rettungssanitäterin, die 2003 mit Blaulicht durch Manhattan rast und Menschen rettet. Bei einem Einsatz stürzt sie in einem verunglückten Wagen in den Fluss und kann erst nach drei Minuten aus dem Wasser gerettet werden. Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit überlebt sie, ist kurz darauf wieder mopsfidel und kann in die Zukunft sehen.
Der Bösewicht Ezekiel Sims (Tahar Rahim) kann ebenfalls in die Zukunft sehen. Er ermordete, weil er an eine seltene Spinnenart gelangen wollte, 1973 in Peru im Amazonas Cassies hochschwangere Mutter. Die eingeborenen, plötzlich aus den Bäumen kommenden Spinnenmenschen versuchen die Mutter und ihr noch ungeborenes Kind zu retten. Sie können allerdings nur Cassie retten.
Heute, also 2003, hat der in New York lebende Ezekiel einen wiederkehrenden Alptraum. Er sieht, wie er irgendwann in der Zukunft von drei maskierten Frauen getötet wird. Er will sie töten, bevor sie ihn töten. Dafür muss er sie zuerst finden. Benutzen tut er die damals moderne Überwachungstechnik, auf die er mit gestohlener NSA-Software zugreifen kann.
Als Cassie in einer ihrer Visionen sieht, wie Spinnenmann Ezekiel in einer U-Bahn die Teenager Julia Cornwall (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O’Connor) und Anya Corazon (Isabela Merced), umbringt, will sie sie retten. Erschwert wird ihre Mission dadurch, dass Ezekiel über Spinnen-Superkräfte verfügt, Julia, Mattie und Anya sind in dem Moment (und während des gesamten Films) nur normale Teenager ohne irgendwelche Superkräfte. Sie verfügen noch nicht einmal über die Teenager-Superkraft, alle Erwachsenen unglaublich zu nerven. Sie sind sehr ruhig, folgsam, einsichtig und halten sich fast immer an Cassies Anweisungen. Und Cassie verfügt nur über die manchmal vorhandene Gabe, in die Zukunft sehen zu können. Das erlaubt der erfahrenen TV-Regisseurin SJ Clarkson in ihrem Spielfilmdebüt, eine Szene mehrmals mit kleinen Variationen zu zeigen.
Diese weitgehende Abwesenheit von irgendwelchen Superkräften erspart uns langwierige Trainings-Montagen, in denen der Superheld seine Kräfte kennen lernt, und macht aus dem angekündigten Superheldenfilm einen eher gewöhnlichen Thriller, in dem der Bösewicht einige Menschen umbringen will und die Heldin das verhindern will.
Für eine Superhelden-Origin-Story ist das schon ein ungewöhnlicher Ansatz. Am Endergebnis ändert das nichts: „Madame Web“ ist ein erstaunlich anspruchsloser Film, der eher an einen TV-Film, bei dem alle nur wegen des Geldes dabei waren, erinnert. Die Schauspieler sind zwar anwesend, aber niemand hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die Dialoge sind zweckdienliche Erklärdialoge, die dann für die Story unwichtig sind. Und die Filmstory wirkt immer so, als habe man nur Teile des Drehbuchs verfilmt. Da fehlen immer wieder Szenen, die die gezeigten Szenen wirkungsvoller machen würden. So sehen wir, zum Beispiel, nicht, wie Cassies Kollegen versuchen, sie aus dem Wasser zu retten. In dem einen Moment ist sie in dem in das Wasser fallendem Auto. Dann ist sie unter Wasser in einer Quasi-Traumsequenz und danach ist sie gerettet und reanimiert. In einer anderen Szene, ebenfalls vom Filmanfang, rast Cassie mit Blaulicht durch die Stadt. Aber warum sie sich so beeilt, wissen wir nicht. Denn wir wissen nichts über den Patienten, den sie befördert. Und ihr Kollege/Freund Ben Parker (Adam Scott; ja, wir können hier eine kleine Verbindung zu Spider-Man erahnen) agiert betont entspannt im hinteren Teil des Rettungswagen. Andere Szenen werden später nicht fortgeführt. Sie bleiben in der Luft hängen. Dafür benutzt Cassie, entgegen jeder Vernunft, während des gesamten Films ein von ihr geklautes und ramponiertes Taxi. Denn zu dem Zeitpunkt wird bereits nach ihr gefahndet und auch nach dem Taxi sollte gesucht werden. Die wenigen Actionszenen versumpfen im erwartbaren CGI-Overkill.
Und obwohl „Madame Web“ zum Sony’s Spider-Man Universe gehört, ist „Madame Web“ ein Einzelfilm ohne irgendwelche offensichtlichen Anspielungen oder Verbindungen zu den „Spider-Man“-Filmen. Diese waren wohl während der Produktion geplant, wurden aber vor dem Kinostart aus dem Film entfernt. Die wenigen jetzt noch vorhandenen Anspielungen auf Spider-Man, nämlich dass Ben Parker und die im Film hochschwangere Mary Parker (so heißt die Mutter von ‚Spider-Man‘ Peter Parker) mitspielen, sind dann so versteckt, dass unklar ist, ob es sich wirklich um eine Verbindung zum Spider-Man Universe oder nur um einen blöden Zufall handelt.
„Madame Web“ ist in seiner allumfassenden Anspruchslosigkeit, wenn man dies akzeptiert, ein durchaus sympathisch-harmloser, sich nicht weiter um Logik und Wahrscheinlichkeit kümmernder Film mit einer angenehm kurzen Laufzeit, der mehr Fernsehen als Kino ist. Als möglicher Start eines Franchises – wobei ich jetzt nicht sagen kann, welches Franchise mit welchen Figuren gestartet werden soll – hat der Film trotz seines niedrigen Budgets von 80 Millionen US-Dollar wohl höchst unklare Zukunftsaussichten.

Madame Web (Madame Web, USA 2024)
Regie: S. J. Clarkson (alternative Schreibweise SJ Clarkson)
Drehbuch: Matt Sazama, Burk Sharpless, Claire Parker, S. J. Clarkson
mit Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott, Emma Roberts, Mike Epps, José María Yazpik, Zosia Mamet, Kerry Bishé
Länge: 117 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Hinweise



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB