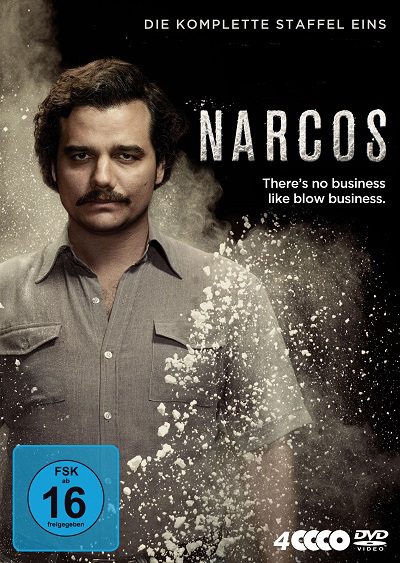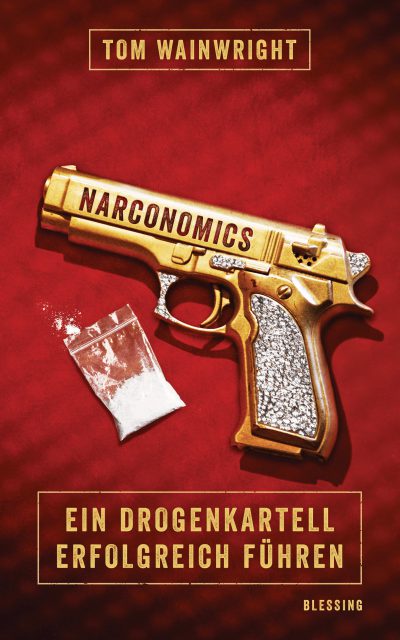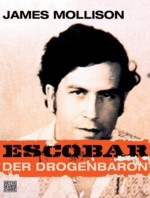Am 27. Juni 1976 entführen Mitglieder der deutschen Terrorgruppe „Revolutionäre Zellen“ und der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ die Air-France-Maschine 139, Das Linienflugzeug landet mit 270 Menschen (12 Besatzungsmitglieder, 258 Passagiere) in Entebbe, wo sie von dem ugandischen Diktator Idi Amin aufgenommen werden. Er quartiert sie in einem leerstehenden Bereich des Flughafens ein.
Die Entführer versuchen in den nächsten Tagen ihre Geisel in der heißen und stickigen Flughafenhalle ruhig zu halten. Sie fordern die Freilassung von 53 in Israel, Frankreich, Deutschland und der Schweiz inhaftierten Terroristen und fünf Millionen US-Dollar.
In Israel fragen sich Premierminister Yitzhak Rabin und sein Verteidigungsminister Shimon Peres, der eine harte Keine-Verhandlungen-Linie verfolgt, wie sie mit der Geiselnahme umgehen sollen. Letztendlich – und das ist für alle, die sich auch nur oberflächlich mit der Geschichte des internationalen Terrorismus in den siebziger Jahren beschäftigten, eine vertraute und bekannte Geschichte – schickt Israel, unter der Leitung von Brigadegeneral Dan Schomron, eine Einheit des Militärs zur Befreiung der über hundert Geisel.
Diese erfolgreiche Befreiung, bei der alle sieben Geiselnehmer, ungefähr zwanzig ugandische Soldaten, ein israelischer Soldat und drei Geisel starben, wurde anschließend mehrmals verfilmt. Wenige Monate nach der Befreiung konkurrierten drei hochkarätig besetzte Filme um die Aufmerksamkeit des Publikums. Am bekanntesten ist heute noch Irvin Kershners „…die keine Gnade kennen“ (mit Charles Bronson, Peter Finch und Horst Buchholz). Unbekannter sind Marvin J. Chomskys „Unternehmen Entebbe“ (mit Burt Lancaster, Elizabeth Taylor und Anthony Hopkins) und Menahan Golans „Operation Thunderbolt“ (mit Klaus Kinski und Sybill Danning).
„7 Tage in Entebbe“-Regisseur José Padilha kämpft in seiner Version der damaligen Ereignisse nicht nur gegen diese Filme an, sondern auch gegen die zahlreichen anderen Thriller, die Flugzeugentführungen schildern und dabei mehr oder weniger dicht an zahllosen weiteren wahren Fällen bleiben. Zum Beispiel der Chuck-Norris-Trash „Delta Force“, der von der Entführung des TWA Flug 847 am 14. Juni 1985 inspiriert war und durchaus eindrucksvoll das Leid der entführten Passagiere und Besatzungsmitglieder schildert. Oder Roland Suso Richters überzeugender Thriller „Mogadischu“ über die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ am 13. Oktober 1977 und die erfolgreiche Geiselbefreiung durch die GSG 9. Um nur zwei Filme zu nennen, in denen eine Flugzeugentführung mit anschließender erfolgreicher Befreiung durch eine Spezialeinheit im Mittelpunkt stehen.
Gegenüber diesen Werken muss ein Remake gerechtfertigt werden. Es muss der bekannten Geschichte neue Facetten abgewinnen.
Drehbuchautor Gregory Burke und Regisseur José Padilha schienen dafür eine gute Wahl zu sein. Gregory Burke schrieb das Drehbuch für den grandiosen, dialogarmen IRA-Thriller „71 – Hinter feindlichen Linien“. José Padilha bewies mit „Tropa de Elite“, „Elite Squad – Im Sumpf der Korruption“ und der Netflix-Serie „Narcos“, dass er in einer Actiondramaturgie gut komplexe Sachverhalte erzählen kann. Mit seinem „Robocop“-Remake setzte er selbstbewusst eigene Akzente. Auch weil er konsequent die naheliegenden Actionszenen vermied. Mit ihnen als Macher und den neuen Erkenntnissen, die sie in ihrem Film verarbeiteten, durfte man auf eine faszinierende, spannende und informative Nacherzählung der damaligen Ereignisse erwarten.
Umso enttäuschender ist dann der Film. Er folgt den historisch verbürgten Ereignissen. Aber er hat überhaupt kein Interesse daran, sie für ein breites Publikum verständlich zu machen. Die Zuschauer, die nichts über den damaligen Linksterrorismus wissen, verstehen nichts. Die Motive der Entführer bleiben rätselhaft. Mehr als einige Soundbytes aus einer Filterblase, deren Bedeutung man nur mit dem nötigen Hintergrundwissen erfasst, bleiben nicht übrig. Entsprechend blass bleiben die Entführer. Das gilt vor allem für Daniel Brühl als Wilfried Böse und Rosamund Pike als Brigitte Kuhlmann. Die anderen Entführer sind noch nicht einmal bessere Nebendarsteller. Die Geisel bleiben eine austauschbare und geduldige Verfügungsmasse, über die man nichts erfährt und für die man sich daher nicht weiter interessiert.
Nur bei den Diskussionen und Machtkämpfen zwischen Yitzhak Rabin und Shimon Peres wird es spannend. In diesen Szenen duellieren sich Lior Ashkenazi (zuletzt, neben Richard Gere, in „Norman“) als Yitzhak Rabin und, gewohnt brillant, Eddie Marsan als Shimon Peres. Sie ringen mit der Frage, wie sie auf die Entführung reagieren sollen und gleichzeitig kämpfen sie um ihre politische Machtposition.
Ein dritter Erzählstrang ist die Vorbereitung und Durchführung der Geiselbefreiung. Für diesen Plot und die Befreiung, die in einem anderen Film die große Actionsequenz wäre, interessiert Padilha sich kaum. Noch konsequenter als in „Robocop“ vermeidet er hier die üblichen Bilder. Anstatt im Detail zu zeigen, wie die Befreiung abläuft, schneidet er in diesen Momenten immer wieder zu dem Stuhltanz aus Ohad Naharins von der Batsheva Dance Company gespieltem Tanzstück „Echad Mi Yodea“. Der Tanz verarbeitet den Zuzug jüdischer Menschen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina. Während der Performance legen die Tänzer immer mehr Kleider ab. Ein Tänzer legt seine Kleidung nicht ab. Er rutscht immer wieder von seinem Stuhl herunter. Der Tanz ist selbstverständlich eine Metapher, die im Rahmen des Films verschieden interpretiert werden kann. Das ist eine interessante Idee, die nicht funktioniert. Der Tanz bleibt ein Fremdkörper im Film.
Dem Film selbst gelingt es nie, die Relevanz der damaligen Ereignisse für die Gegenwart deutlich zu machen. Und als Geschichtsstunde funktioniert er auch nur bei den Menschen, die über ein ordentliches Hintergrundwissen zu den damaligen Ereignissen, Diskussionen und Auswirkungen verfügen.
Für alle anderen bleibt nur ein beliebiger Entführungsthriller mit viel 70-Jahre-Patina und etwas Revolutionärskitsch.

7 Tage in Entebbe (7 Days in Entebbe, USA/Großbritannien 2018)
Regie: José Padilha
Drehbuch: Gregory Burke
mit Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan, Lior Ashkenazi, Denis Menochet, Ben Schnetzer, Nonso Anozie
Länge: 107 Minuten
FSK: ?
–
Hinweise
Moviepilot über „7 Tage in Entebbe“
Metacritic über „7 Tage in Entebbe“
Rotten Tomatoes über „7 Tage in Entebbe“
Wikipedia über „7 Tage in Entebbe“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von José Padilhas „Tropa de Elite“ (Tropa de Elite, Brasilien/USA 2007)
Meine Besprechung von José Padilhas „Robocop“ (Robocop, USA 2014)
Meine Besprechung von José Padilhas „Narcos – Die komplette erste Staffel“ (Narcos, USA 2015)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB