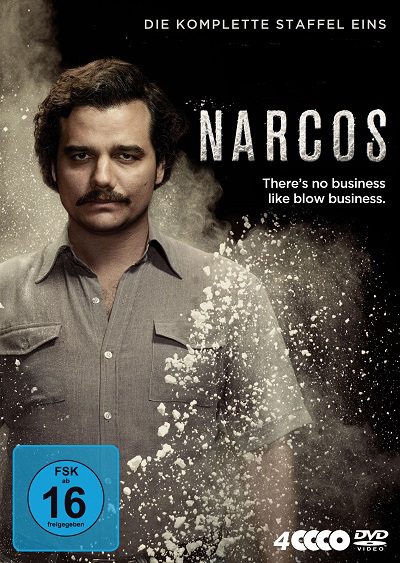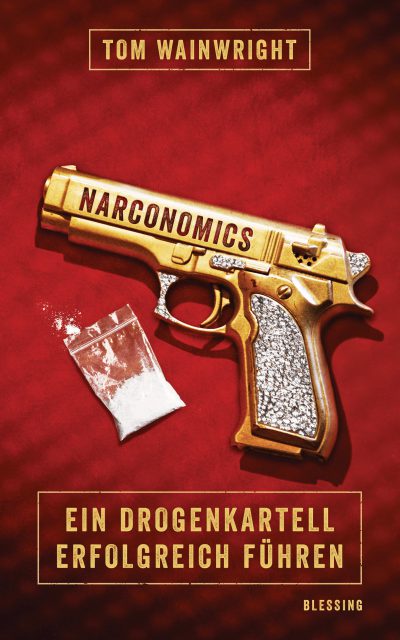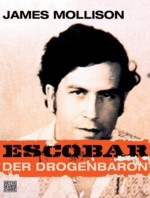Bürgerkrieg in den USA. Während sich die verschiedenen Kriegsparteien bekämpfen, machen sich die erfahrenen Kriegsjournalisten Joel (Wagner Moura) und Lee (Kirsten Dunst) auf den Weg von New York nach Washington, D. C.. Es sind etwas über dreihundert Kilometer durch ein Kriegsgebiet, in dem die Fronten vollkommen unklar sind und ein Menschenleben nichts zählt.
Joel will in der Hauptstadt den US-Präsidenten interviewen. Lee soll fotografieren. Begleitet werden sie von ihrem älteren, ebenfalls kriegserfahrenen Kollegen Sammy (Stephen McKinley Henderson) und der blutigen Anfängerin Jessie (Cailee Spaeny), die Lee bewundert und sich in die Reisetruppe eingeschlichen hat.
Zwischen Lee und Jessie entwickelt sich während der Reise ein Mentorin/Schülerin-Verhältnis. Gleichzeitig erzählt der Film eine doppelte Entwicklungsgeschichte. Auf der einen Seite ist die zunehmend kriegsmüde Lee, auf der anderen Seite Jessie, die zunehmend in den Job hineinwächst und sich über den Adrenalinschub freut.
Alex Garland, der Autor von „The Beach“ (verfilmt von Danny Boyle), den Drehbüchern „28 Days Later“ (verfilmt von Danny Boyle), „Sunshine“ (verfilmt von Danny Boyle) und „Dredd“ (verfilmt von Pete Travis) und, nach seinen Drehbüchern, der Regisseur von „Ex Machina“, „Auslöschung“ und „Men – Was dich sucht, wird dich finden“, inszenierte jetzt, selbstverständlich nach seinem Drehbuch, „Civil War“. Im Zentrum seiner neuesten Dystopie steht die Fahrt der vier Journalisten durch das Kampfgebiet als eine Abfolge von Episoden, in denen sie immer wieder Soldaten und anderen spärlich uniformierten Kämpfern begegnen. Immer ist unklar, ob sie die Begegnung überleben werden und immer ist unklar, auf welcher Seite die Soldaten kämpfen. Sie kämpfen halt und erschießen alles, was ihnen vor die Flinte gerät.
An einer irgendwie gearteten Durchdringung des Konflikts ist Garland nicht interessiert. Er erwähnt nur, dass der US-amerikanische Präsident gerade in seiner dritten Amtszeit ist (von zwei nach der Verfassung möglichen) und die „Westlichen Streitkräfte“, eine Koalition von Kalifornien und Texas, gegen die Regierung kämpft. Aber wenn die vier Journalisten dann durch das Kriegsgebiet fahren, kämpfen nur Menschen gegen Menschen. Wer auf welcher Seite kämpft ist unklar. Für was gekämpft wird, ist ebenso unklar. Warum sie gegeneinander kämpfen, ist auch unklar. Das ist zwar immer wieder, wenn die Journalisten in einer Garage gerade Gefolterte und Erhängte entdecken, in das Visier eines gesichtslosen Scharfschützen geraten oder einem von Jesse Plemons gespielten sadistischen Soldaten begegnen, als einzelne Episode spannend, aber auch schnell redundant. Im Gegensatz zu Francis Ford Coppolas „Apocalypse Now“ ergibt sich aus den einzelnen Begegnungen kein vielschichtiges Bild des Krieges, sondern nur das immergleiche Bild, in dem US-amerikanische Soldaten andere US-Amerikaner umbringen. Eine tiefere philosophische Bedeutung ist dabei höchstens erahnbar.
Es ist auch unklar, was die Film-USA mit den realen USA zu tun haben. Das ist, zum Beispiel, in den „The Purge“-Filmen anders. Bei dieser Dystopie ist das Ziel der Kritik und Wut der Macher klar erkennbar. Schon im ersten „The Purge“-Film wurde skizziert, wie die „The Purge“-USA aus der real existierenden USA entstehen konnte. Bei den „The Purge“-Filmen ist daher auch klar, welche politischen Einstellung und Akteure angegriffen werden und wer das Kino verärgert verlassen soll. In „Civil War“ dürfte sich niemand in seiner politischen Einstellung angegriffen fühlen, jeder kann sich in seiner politischen Einstellung bestätigt fühlen, weil „Civil War“ als Parabel offen für jede Interpretation des Ursprungs des Konflikts ist. Das führt dazu, dass Garland keine Idee hat, wie der Bürgerkrieg entstanden ist und wie er hätte verhindert werden können. Er zeigt nur noch, überaus fotogen und gut inszeniert, sinnlose, nicht weiter berührende Gewalt.
Die vier Journalisten, die auf der Suche nach der großen Story durch das Kriegsgebiet fahren, dokumentieren diese Gewalt. Ihr moralisches Wertesystem oder ihre Ansichten über die Konfliktparteien werden nicht auf die Probe gestellt, weil sie keine Position zu diesem Konflikt haben. Es reicht gerade so zu einem banalen, allgemein zustimmungsfähigen „Krieg ist schlimm.“. Lee, Joel, Sammy und Jessie stehen vor keinem Dilemma. Wie Katastrophenjournalisten, die nur das eindrucksvolle Bild für ihr Fotoalbum haben wollen, fotografieren Lee und Cassie die Zerstörung, die Leichen und die Täter. Der schreibende Teil des Journalismus wird ignoriert. Recherche ist ein Fremdwort. Die Zusammenarbeit mit der Redaktion und die Frage, welche Meldungen und Bilder einen Nachrichtenwert haben, ebenso. Bei Garland reicht es nur zu einem seht und bewundert die tapferen Journalisten, die sich mitten in das Kampfgeschehen begeben.
„Civil War“ hätte der Film der Stunde, ein Statement zur aktuellen Situaiton in den USA und ein Warnruf werden können. Stattdessen vergeigt er das mit seinem apolitischen Ansatz und dem damit verbundenem Desinteresse an den Motiven der Konfliktparteien. Die so entstehende Kriegspornographie überschüttet er mit oberflächlichem Pathos über tapfere Journalisten.
Garlands neuestes Werk ist eine ziemlich Enttäuschung und ein erschreckend belangloser Film.

Civil War (Civil War, USA 2024)
Regie: Alex Garland
Drehbuch: Alex Garland
mit Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons, Nick Offerman
Länge: 109 Minuten
FSK: ab 16 Jahre
–
Hinweise
Rotten Tomatoes über „Civil War“
Wikipedia über „Civil War“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Alex Garlands „Ex Machina“ (Ex Machina, USA/Großbritannien 2014)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB