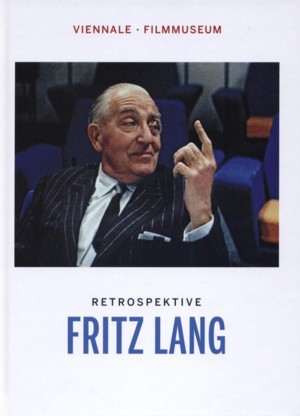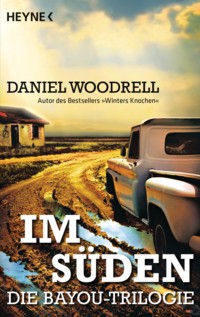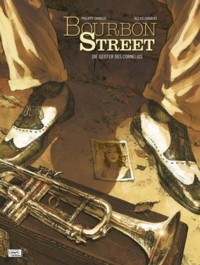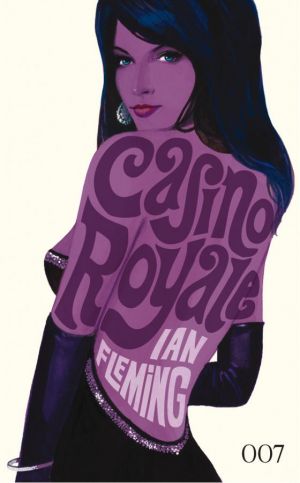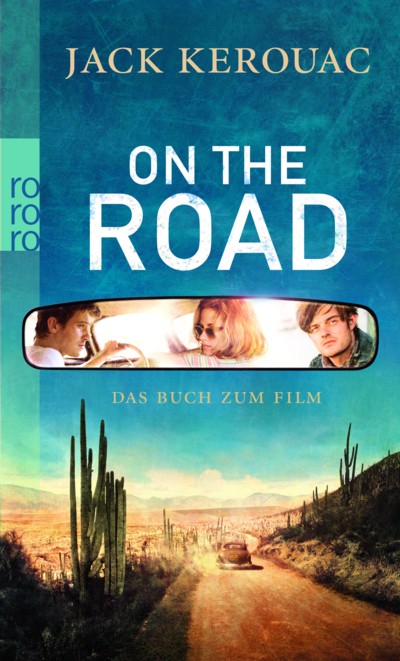Als ich „Psycho“ zum ersten Mal las, war ich erstaunt, wie sehr Alfred Hitchcocks Film sich von Robert Blochs Roman unterscheidet.
Als ich „Psycho“ jetzt zum zweiten Mal las, war ich erstaunt, wie viel Alfred Hitchcock in seinen Film übernommen hat.
Aber einen großen Unterschied gibt es: im Buch sieht Norman Bates anders aus als im Film. Denn Norman-Bates-Darsteller Anthony Perkins (in der Rolle seines Lebens) ist kein dicker Mann mit einem rundlichen Gesicht, rosafarbener Kopfhaut, sich lichtendem sandfarbenem Haar und einer randlosen Brille.
Die Grundstruktur der Geschichte wurde von Drehbuchautor Joseph Stefano und Regisseur Alfred Hitchcock allerdings erstaunlich genau übernommen.
Norman Bates betreibt das einsam gelegene Bates Motel, er wird von seiner herrischen Mutter unterdrückt und Mary Crane mietet sich eines Nachts bei ihm ein. Sie wird im Badezimmer ermordet und Norman bringt die Leiche weg. Marys Schwester Lila und Marys künftiger Ehemann Sam Loomis suchen sie und wir erfahren im Roman schon nach zwei Dritteln, dass Normans Mutter seit zwanzig Jahren tot ist.
Weitere große Unterschiede zwischen dem Roman und dem Film sind, dass in Blochs Roman das erste Drittel des Films (also Marys Diebstahl und ihre Fahrt zu ihrem Künftigem, Sam Loomis) in einem kurzen Rückblick eingefügt wird und wir in dem Roman mehr über Norman Bates erfahren.
„Psycho“ ist ein spannender Kriminalroman, der wirklich geschickt mit den Erwartungen spielt und, wenn man weiß (was inzwischen ja als Allgemeinwissen vorausgesetzt werden kann), dass Mutter nur in Normans Vorstellung lebt und er die Morde begeht, fällt beim Lesen auf, wie geschickt Robert Bloch den Wahnsinn und die Schizophrenie von Norman Bates zeichnet und den Leser, wenn er das nicht weiß, auf eine falsche Fährte lockt.
Der Roman liegt jetzt in einer neuen Übersetzung vor, die als Grundlage den von Robert Bloch kurz vor seinem Tod am 23. September 1994 überarbeiteten Text nimmt, und er ist auch bei einer wiederholten Lektüre mit unter zweihundert Seiten ein kleiner, fieser Thriller.
Über zwanzig Jahre später kehrte Robert Bloch wieder zu Norman Bates zurück und obwohl sein Roman „Psycho 2“ heißt, hat er mit dem zeitgleich im Kino laufenden Horrorfilm „Psycho 2“, außer dem Hauptcharakter, nichts zu tun.
In Robert Blochs Roman ist Norman Bates nicht geheilt. Er sitzt immer noch in einer Irrenanstalt und liest viel. Während eines Gewitters nutzt er, im allgemeinen Chaos, einen unbewachten Moment aus. Er bringt eine Nonne, die mit ihm über seine Taten reden wollte, um und zieht sich ihre Tracht an. Er kann die Anstalt verlassen und als er mit dem Lieferwagen der Nonne flüchten will, entdeckt ihn ihre Ordensschwester, und er muss sie mitnehmen. Kurz darauf bringt er sie um und verbrennt sie in ihrem Auto. Die Polizei glaubt, dass die zweite Leiche der flüchtige Norman Bates ist. Aber sie weiß nicht, dass Norman auf seiner Flucht auch einen Anhalter mitgenommen hat.
Normans Psychiater Dr. Adam Claiborne glaubt jedenfalls nicht, dass Norman Bates tot ist. Er glaubt, dass der Flüchtling in Fairdale Sam Loomis und dessen Frau Lila ermordete und jetzt auf dem Weg nach Hollywood ist. Denn dort will ein Hollywood-Produzent einen Horrorfilm über Norman Bates drehen.
Claiborne, der sich für seinen Patienten verantwortlich fühlt, will weitere Morde verhindern. Er macht sich auf den Weg nach Hollywood.
Und wenn die Geschichte von „Psycho II“, die als geradliniger Flucht-Thriller beginnt, in Hollywood ankommt, entwirft Robert Bloch ein Sittengemälde der Filmstadt, das sicher von eigenen Erlebnissen des Drehbuchautors mit Produzenten, Regisseuren und Schauspielern inspiriert ist. Es gibt auch ätzende Kommentare zu den immer gewalttätiger und sexistischer werdenden neuen Horrorfilmen und Erinnerungen an Hollywoods Stummfilmära.
Im letzten Drittel verirrt die Geschichte sich dann auf einige Nebenschauplätze, wie einem Bordell, in dem Schauspieler-Doppelgänger ihre sexuellen Dienste einer männlich-homosexuellen Kundschaft anbieten.
Trotzdem ist „Psycho II“ ist eine würdige Fortsetzung.
–
Robert Bloch: Psycho – Ungekürzte Neuübersetzung, mit einer Nachbemerkung des Autors
(übersetzt von Hannes Riffel)
Golkonda, 2012
192 Seiten
14,90 Euro
–
Originalausgabe
Psycho – 35th Anniversary Edition
Gauntlet Publications, 1994
–
Erstausgabe
Psycho
Simon and Schuster, 1959
–
Robert Bloch: Psycho 2
(übersetzt von Willy Thaler)
Heyne, 1983
256 Seiten
(nur noch antiquarisch erhältlich)
–
Originalausgabe
Psycho II
Whispers Press, 1982
–
Hinweise
The Unofficial Robert Bloch Website
Wikipedia über Robert Bloch (deutsch, englisch)

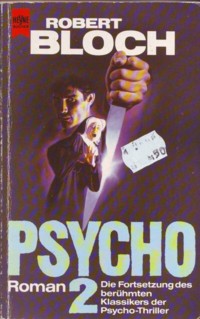



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB