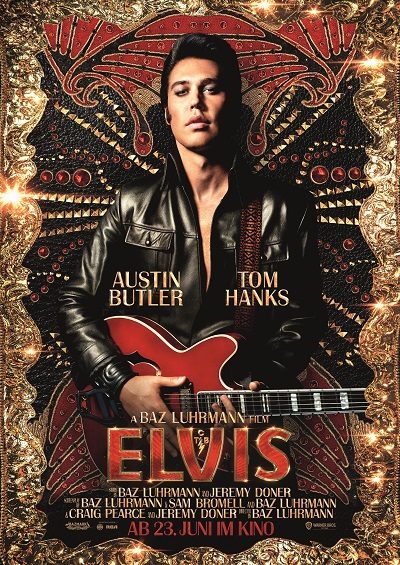1959 trifft Priscilla Beaulieu in Deutschland auf einer US-Militärbasis Elvis Presley. Der 24-jährige Weltstar musste für seinen zweijährigen Militärdienst seine gut laufende Karriere als Musiker unterbrechen. Sie ist vierzehn Jahre und, wie viele Teenager, über beide Ohren verliebt in den Rockmusiker. Vor allem nachdem der an Einsamkeit und Heimweh leidende, feinfühlige und sehr höfliche Musiker sich für sie interessiert.
Ihre Eltern sind zunächst skeptisch, aber nachdem Elvis ihnen verspricht, auf Priscilla aufzupassen, darf sie ihn abends begleiten. Nach dem Ende seines Militärdienstes halten sie weiter Kontakt. 1963 zieht die siebzehnjährige Schülerin, mit dem Einverständnis ihrer Eltern, zu Elvis nach Graceland. Elvis hat ihnen versprochen, Priscilla zu heiraten, sobald sie volljährig ist. 1967 heiraten sie. Ihre 2023 verstorbene Tochter Lisa Marie Presley kommt neun Monate nach der Hochzeitsnacht auf die Welt. 1972 trennen Elvis und Priscilla Presley sich. Ein Jahr später erfolgt die Scheidung.
Das sind die historisch verbürgten, allgemein bekannten Eckpunkte, die auch den Rahmen für Sofia Coppolas neuen Film „Priscilla“ liefern. Und die sie zu einer weiteren Studie in Ennui benutzt.
Elvis hängt zwar manchmal zwischen Konzerten und Filmdrehs mit seinen Freunden in Graceland ab, aber in Coppolas Film ist er nur eine Nebenfigur. Im Zentrum steht Priscilla, die sich in Graceland langweilt, alleine ist und melancholisch aus dem Fenster starrt. Sie ist eine Quasi-Gefangene. Sie macht Hausaufgaben, während unten gefeiert wird. Sie erträgt in ihren Privatgemächern die wechselnden Launen von Elvis. Mal ist er herrisch, mal liebevoll, mal wissbegierig.
Dazu präsentiert Coppola Rocksongs, die zu Priscillas Gefühlen passen. Auch wenn die Songs erst später veröffentlicht wurden. Einige Cover-Versionen von Elvis-Presley-Songs sind auch dabei. Diesen freimütigen Umgang mit der Musik praktizierte sie erstmals in ihrem Biopic „Marie Antoinette“. In dem im 18. Jahrhundert in Versailles spielendem Historiendrama kommentieren moderne, teils bekannte Rocksongs die Handlung. Das funktioniert überraschend gut und wurde seitdem von anderen Regisseuren kopiert. Zum Beispiel zuletzt von Frauke Finsterwalder in ihrem Kaiserin-Sisi-Film „Sisi & Ich“.
In „Priscilla“ wurde ihr dieser Schritt von den Rechteinhabern der Elvis-Presley-Songs aufgezwungen. Sie verweigerten ihr die Benutzung und zwangen sie zu der jetzt zu hörenden Musikauswahl. Ihr Mann Thomas Mars und seine Indie-Rockband Phoenix waren für die Songauswahl und Teile der Filmmusik verantwortlich.
Auch sonst bewegt Sofia Coppola sich in „Priscilla“ mit vertrauten Stilmitteln auf vertrautem Terrain. Wieder, wie vor allem in „Lost in Translation“, „Somewhere“ und, mit Einschränkungen, „Die Verführten“ (The Beguiled), vermittelt sie überzeugend das Gefühl, das ihre Protagonistin in einem ereignislosen Warte- und Schwebezustand sind. Priscilla lernt Elvis als Kind kennen und verlässt ihn vierzehn Jahre später als Frau, die die Welt außerhalb ihres goldenen Käfigs nicht kennt. Dazwischen wartet sie auf ihren ständig abwesenden Mann.
Coppola inszeniert diese Ereignislosigkeit sehr gut, aber auch mit einem Hang zur gepflegten Langeweile. Die farbentsättigten Bilder gefallen, die Ausstattung ist stimmig, die Schauspieler sind gut, die Musik ist wohlig vertraut, die Story plätschert vor sich hin. Wenn Priscilla am Filmende Elvis und Graceland verlässt, passiert das weniger wegen eines bestimmten Ereignisses, sondern weil Elvis‘ Verhalten in dem Moment der berühmte letzte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es ist der Moment, in dem sie sich sagt, dass der Rest ihres Lebens anders sein soll.
Wer dagegen mehr über Priscilla Presley oder Einzelheiten über ihre Beziehung erfahren möchte, muss andere Filme und Bücher, wie Priscilla Presleys Biographie, auf der Coppolas Film lose basiert, studieren.

Priscilla (Priscilla, USA 2023)
Regie: Sofia Coppola
Drehbuch: Sofia Coppola
LV: Priscilla Presley: Elvis and Me, 1985 (Elvis und ich)
mit Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Domińczyk, Tim Post, Lynne Griffin
Länge: 113 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Hinweise
Rotten Tomatoes über „Priscilla“
Wikipedia über „Priscilla“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Sofia Coppolas „The Bling Ring“ (The Bling Ring, USA 2013)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB