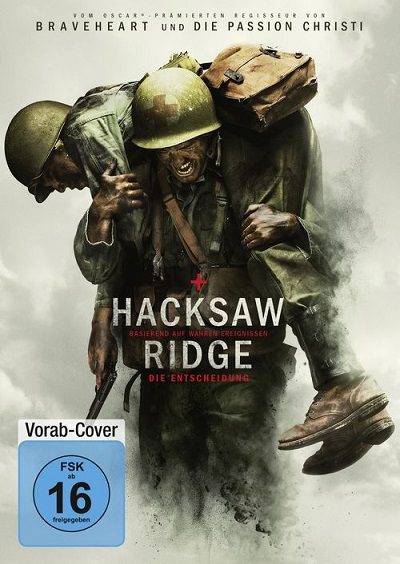Fans von Elvis Presley kommen in Baz Luhrmanns Biopic „Elvis“ auf ihre Kosten. Es gibt viel Elvis Presley, viel Musik und, bei seinen Liveauftritten, eine schweißtreibende animalische Entfesselung, die uns Spätgeborenen zeigt, warum in den Fünfzigern Eltern ihre Kinder vor diesem Mann beschützen wollten; – auch wenn Luhrmann hier wahrscheinlich schamlos übertreibt. Auch die Besetzung ist nicht ohne. Austin Butler (Tex Watson in „Once upon a time…in Hollywood“) spielt Elvis Presley. Tom Hanks spielt Colonel Tom Parker, den äußerst geschäftstüchtigen und skrupellosen Manager von Elvis Presley. Bevor er Presleys Entdecker, Förderer und Manager wurde, war er Schausteller auf Jahrmärkten. Mit Wanderzirkussen tingelte er durch die US-Provinz. Von Musik hatte er keine Ahnung. Von einem guten Geschäft schon und das sah er in Presley. Er ist der unzuverlässige Erzähler von Luhrmanns Biopic und damit ist von der ersten Minute an klar, dass im Zweifel eine gute Geschichte über die Fakten triumphiert. Soweit sie überhaupt bekannt sind.
Der Anfang und, ungefähr die erste Stunde des gut dreistündigen Films, ist furios. Danach scheint alle kreative Energie aufgebraucht zu sein. Damit ähnelt „Elvis“ dem Leben von Elvis Presley. Er wird am 8. Januar 1935 in East Tupelo, Mississippi, als Sohn eines Landarbeiters geboren. 1953 nimmt er seinen ersten Song für Sun Records auf. Schnell begeistert er die Massen und wird zum „King of Rock ’n’ Roll“. Er macht Blues, Gospel und Soul, also Schwarze Musik, mit einer Prise Country, für den weißen Musikhörer goutierbar.
Sein Manager, Colonel Tom Parker, ein, wie gesagt, äußerst halbseidener Charakter, sorgt dafür, dass sie viel Geld verdienen. Da sind Presleys Monate als Soldat von 1958 bis 1960 in Deutschland nur eine kurze Unterbrechung von den Live-Auftritten, die mit Schallplatten überbrückt werden.
Danach tritt Presley in über dreißig Hollywood-Filmen auf, die bis auf Don Siegels „Flammender Stern“ (Flaming Star), vergessenswerte Fließband-Musicals sind. Ab 1969 gastiert er in Las Vegas. Aus finanzieller Sicht ist das eine ertragreiche Zeit. Künstlerisch nicht.
Am 16. August 1977 stirbt er in seiner Villa Graceland in Memphis, Tennessee.
Luhrmann („Moulin Rouge“, „Der große Gatsby“) erzählt Presleys Leben chronologisch nach. Das ist bis zu seinem Aufenthalt in Deutschland als Soldat atemberaubend dicht erzählt. Wenig subtil, aber mitreisend, erzählt Luhrmann von Presleys Faszination für die Schwarze Musik. Zuerst hört er als Kind in einer Spelunke, die nur von Schwarzen besucht wird, den Blues. Dann hört er auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem Gottesdienst den Gospel und er ist…, nach den Filmbildern, ekstatisch besessen. Luhrmann springt in der Zeit hin und her, verdichtet und arbeitet auch mit Texteinblendungen. Das ist überbordend, maßlos und gerade deshalb mitreißend und voller Energie.
Danach handelt Luhrmann die weiteren Stationen und Jahre in Presleys Leben in gepflegter Biopic-Manier ab. Zunehmend redundant folgt ein Auftritt auf das nächste Gespräch, in dem Presley wieder sagt, er möchte eine Welttournee machen, ehe er wieder in Las Vegas auftritt und seine größten Hits präsentiert. Nichts bewegt sich in dieser Wiederholungsschleife. Unangenehmes, wie Presleys gesundheitliche Probleme, sein Drogenkonsum, seine Paranoia und sein zunehmend irrationales Verhalten, wird angesprochen weil es unbedingt angesprochen werden muss. Seine Waffensammlung wird mal gezeigt. Mit seiner dann Ex-Frau Priscilla trifft er sich am Flughafen. Aber diese Bilder hängen ohne einen Zusammenhang und ohne eine Auswirkung auf die Geschichte in der Luft.
In dem Moment löst Luhrmann sich immer mehr von seiner Prämisse nach der die Geschichte von Elvis Presley aus der Perspektive von Colonel Parker erzählt wird. Parker verschwindet aus dem Film. Stattdessen gibt es immer mehr Szenen, in denen Dinge passieren, von denen Parker nichts weiß und auch niemals erfährt. In dem Moment wird auch die Möglichkeit, das Leben von Elvis Presley aus einer radikal subjektiven und damit mit Fakten locker umgehenden Sicht zu schildern, zugunsten eines konventionellen Biopics aufgegeben, das dann ähnlich locker mit Fakten umgeht, aber implizit behauptet, die Wahrheit zu schildern. Alle negativen Aspekte von Presleys Persönlichkeit werden konsequent herunterspielt.
Das ist insofern verständlich, weil „Elvis“ kein kleiner Independent-Film ist (wie „Elvis & Nixon“), sondern mit einem offiziellem Budget von 85 Millionen US-Dollar ein Film ist, der ein breites Mainstream-Publikum und die Elvis-Fans erreichen will. Das darf dann nicht übermäßig kritisch sein. Stattdessen muss das Biopic die bekannten Hits und Konzertausschnitte präsentieren. Deshalb werden so viele Auftritte von Presley in Las Vegas gezeigt. Für den Elvis-Kult sind sie wichtig. Die echte, innovative Rockmusik fand an anderen Orten statt und wurde von anderen Musikern gespielt.
Mit gut drei Stunden ist „Elvis“ ein viel zu lang geratenes Biopic, das an seiner Länge, seinem Drang, das ganze Leben einer Figur zu schildern, und einer letztendlich unklaren Haltung zu ebendieser Figur krankt.
Wer allerdings den Saal verlässt, wenn Elvis Presley deutschen Boden betritt, sieht einen guten Film.
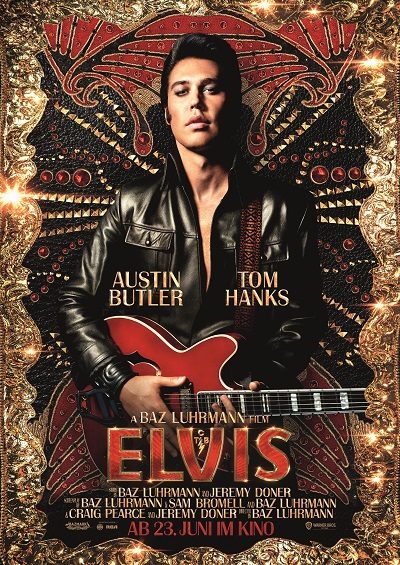
Elvis (Elvis, USA 2022)
Regie: Baz Luhrmann
Drehbuch: Baz Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce, Jeremy Doner (nach einer Geschichte von Baz Luhrmann und Jeremy Doner)
mit Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, Kodi Smit-McPhee, Luke Bracey, Gary Clark Jr., Yola
Länge: 160 Minuten
FSK: ab 6 Jahre
–
Hinweise
Wikipedia über „Elvis“ (deutsch, englisch) und Elvis Presley (deutsch, englisch)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB