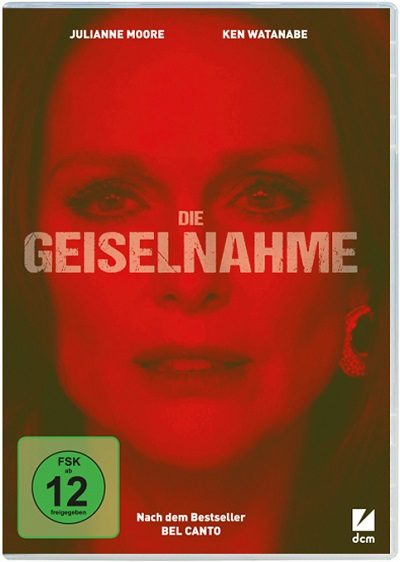„Black Panther: Wakanda forever“ beginnt mit der episch zelebrierten Trauerfeier für T’Challa mit bunten Bildern aus Wakanda, Trommeln, Tänzen und Slow-Motion. Den Abschluss bildet das ihm zu Ehren geändertem Marvel-Logo.
Der Grund dafür ist der Tod von T’Challa-Darsteller Chadwick Boseman. Er starb am 28. August 2020. 2018 spielte er den schwarzen Helden in dem bei der Kritik und dem Publikum sehr erfolgreichem Superheldenfilm „Black Panther“. Danach war Boseman Black Panther. Nach seinem Tod entschlossen die Macher sich, die Rolle nicht einfach kommentarlos mit einem anderem Schauspieler neu zu besetzen (Remember „Hulk“?), sondern die Geschichte weiter zu erzählen und dieses Mal T’Challas jüngere Schwester Shuri in den Mittelpunkt zu stellen.
Dummerweise hat Letitia Wright nie die Präsenz von Chadwick Boseman. Schmerzhaft deutlich wird das am Ende des Films, wenn Regisseur Ryan Coogler wieder einige Bilder von Boseman als T’Challa zeigt. In diesen nur sekundenlangen Ausschnitten überzeugt er als charismatischer Held. Shuri wirkt dagegen, auch wenn sie in den vorherigen zweieinhalb Stunden etliche Abenteuer überstanden hat, wie der Ersatzmann, der die Position nicht ausfüllen kann.
Das kann teilweise an ihr liegen. Zu einem größeren Teil liegt das an ihrer Figur und am Drehbuch. Sie ist die kleine Schwester von T’Challa. Sie ist ein Wissenschafts-Nerd, der sich gerne im Labor vergräbt und von ihrer Kleidung und ihrem Gehabe immer noch in der Pubertät steckt. Sie mag vielleicht das Mädchen sein, mit dem man Pferde stiehlt, aber sie ist nicht die Herrscherin über ein Volk und sie ist keine Kriegerin. Ersteres wird von ihrer Mutter, Königin Ramonda (Angela Bassett), letzteres von Okoye (Danai Gurira), der Anführerin der Elite-Kriegerinnen Dora Milaje, überzeugend erledigt.
Das Drehbuch ist eine beliebige Ansammlung von Szenen. Während des gut dreistündigen Films fragte ich mich öfters, um was zur Hölle es denn jetzt eigentlich geht, was die Motive der Bösewichter sind, sofern sie überhaupt die Bösewichter sind, und was ich von der präsentierten Gesellschaft halten soll.
Wakanda ist, für alle, die „Black Panther“ nicht gesehen oder wieder vergessen haben, ein in Afrika liegendes Königreich, das sich Ewigkeiten von der Welt abschirmte. Niemand wusste von seiner Existenz. Inzwischen ist es als Staat anerkannt.
In Wakanda wird eine merkwürdige Mischung aus Tradition und Moderne gepflegt. Die Tradition ist viel afrikanische Folklore und ein im Mittelalter stecken gebliebenes Gesellschaftssystem von Königen, Kriegern und Fußvolk. Es ist auch das Gesellschaftssystem, das wir aus unzähligen Fantasy- und schlechten Science-Fiction-Filmen kennen. Gleichzeitig hat diese Erbmonarchie, die sich Jahrhunderte mit einem Schutzschild vor dem Rest der Welt verborgen hielt, Waffen und Fortbewegungsmittel, die wir sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Außerdem verfügt Wakanda über das Metall Vibranium, das für viele friedliche und kriegerische Zwecke eingesetzt werden kann.
Ein Jahr nach dem Tod von T’Challa, streiten Wakanda und die anderen Staaten sich darüber, wer Vibranium besitzen darf und wie der Besitz und die Verwendung kontrolliert werden können. Die anderen Staaten hätten gerne ein Kontrollregime. Wakanda hält von dieser grundvernünftigen Forderung nichts und behauptet, ganz in der Tradition größenwahnsinniger Diktatoren, dass nur in ihren Händen Vibranium sicher sei und die Menschheit ihnen vertrauen solle.
Bevor dieser durchaus interessante Konflikt zwischen Wakanda und dem Rest der Welt vertieft werden kann, versucht eine zunächst unbekannte, aber gut ausgestattete Gruppe (es ist, wie wir später erfahren, die CIA) unter Wasser an dort liegendes Vibranium zu kommen. Sie werden von Namor (Tenoch Huerta Mejia), dem König des Unterwasserreiches Talokan, und seinen Männern umgebracht.
Talokan ist die Marvel-Variante des aus „Aquaman“ bekannten DC-Unterwasserreiches Atlantis. Nur dass hier alles eine Spur dunkler ausfällt. Die Talokaner haben normalerweise eine blaue Hautfarbe, die sofort an die aus „Avatar“ bekannten Na’vi erinnert.
Nachdem Namor verhindern konnte, dass das Vibranium in die falschen Hände fällt, schlägt er Königin Ramonda, die bislang nichts von Talokan wusste, eine Zusammenarbeit gegen den unbekannte Feind vor.
Kurz nach dem positiven Start ihrer Zusammenarbeit zerstreiten sie sich über die neunzehnjährige geniale Erfinderin Riri Williams (Dominique Thorne). Shuri und Okoye retteten sie vor einer Hundertschaft schießwütiger Polizisten und FBI-Agenten. Diese Actionszene findet, wie die meisten Actionszenen in „Black Panther: Wakanda forever“, weitgehend im Dunkeln statt. Sie unterscheidet sich kaum von den aus anderen Superheldenfilmen.
Nachdem sie die Neunzehnjährige retten konnten, möchte Shuri mit Riri in Wakanda in ihrem High-Tech-Labor forschen. Namor will Riri töten. Er hält sie für eine Bedrohung.
Fortan steht, unterbrochen von familiären Anwandlungen und der anderen Bedrohung, der eskalierende Krieg zwischen Wakanda und Talokan im Mittelpunkt des Films.
Unentschlossen und ohne jemals einen klaren Fokus zu finden, pendelt „Black Panther: Wakanda forever“ zwischen den einzelnen Plotideen hin und her. Garniert wird das mit einer Best-of-Africa-Klischeeparade, austauschbaren Actionszenen und ärgerlich fehlgeleiteten Vorstellungen von Herrschaft und Politik.
Insgesamt reiht „Black Panther: Wakanda forever“ sich nahtlos in die aktuelle, enttäuschende Phase des Marvel-Cinematic-Universe-Phase ein. Wenn der Film an der Kinokasse nicht so erfolgreich wie andere MCU-Filme ist, ist zu befürchten, dass danach wieder behauptet wird, Frauen könnten keine Superheldenfilme stemmen. Dabei liegt es nicht am Geschlecht und der Hautfarbe der Hauptfigur, sondern an dem schlechten Drehbuch und der schlechten Ausführung.
Wie es besser geht, zeigte vor wenigen Wochen Gina Prince-Bythewood in „The Woman King“.

Black Panther: Wakanda forever (Black Panther: Wakanda forever, USA 2022)
Regie: Ryan Coogler
Drehbuch: Ryan Coogler, Joe Robert Cole
LV: Charakter von Stan Lee und Jack Kirby
mit Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejia, Alex Livinalli, Mabel Cadena, Dominique Thorne
Länge: 162 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Hinweise
Deutsche Facebook-Seite von Marvel
Moviepilot über „Black Panther: Wakanda forever“
Metacritic über „Black Panther: Wakanda forever“
Rotten Tomatoes über „Black Panther: Wakanda forever“
Wikipedia über „Black Panther: Wakanda forever“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Ryan Cooglers „Creed“ (Creed, USA 2015)
Meine Besprechung von Ryan Cooglers „Black Panther“ (Black Panther, USA 2018)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB