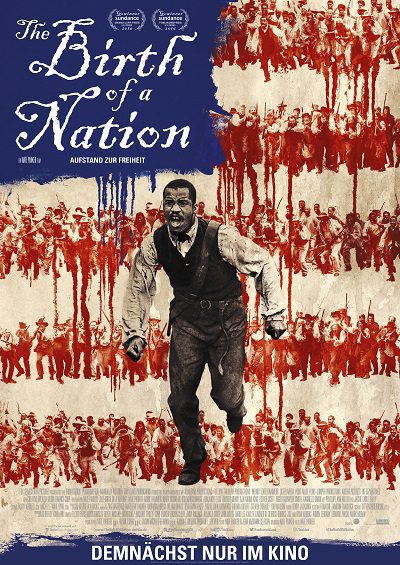Wie „Kill Bill“ wurde „Wicked“ von Anfang an als Zweiteiler gedreht. Das ist die einzige Gemeinsamkeit zwischen Quentin Tarantinos Meisterwerk und Jon M. Chus Musical „Wicked“. Bei „Kill Bill“ war die Begründung, dass zu viel gutes Material für einen Film vorhanden sei. Bei „Wicked“ war es nur die von Anfang an abstruse Behauptung, dass das Musical zu lang für einen einzigen Spielfilm sei. Jetzt haben wir zwei Filme, die es auf insgesamt gut dreihundert Minuten bzw. fünf Stunden schaffen. Der erste Film erzahlt die Ereignisse des Musicals bis zur Pause. Der zweite Film die Ereignisse nach der Pause – und weil bei einem Theaterstück niemand erst in der Pause ins Theater kommt, gibt es auch keine Einführung in die Geschichte. Die Macher gehen davon aus, dass alle den ersten Teil gesehen haben.
Das erleichtert mir auch etwas die Arbeit. Ich kann auf meine Kritik zum ersten Teil verweisen und betonen, dass alles, was ich am ersten Teil furchtbar fand, auch auf den zweiten Teil zutrifft.
Inzwischen leben Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) in Oz in verschiedenen Welten. Laut Drehbuch sind sie beste Freundinnen. Dass diese beiden gegensätzlichen, eindimensionalen Figuren – hier die auf ihre Aussehen bedachte Dumpfnudel, da die überschlaue, wegen ihrer Hautfarbe ausgestoßene Zauberin – beste Freundinnen sind, war schon im ersten Teil eine unglaubwürdige Drehbuchbehauptung. Im zweiten Teil ist diese Behauptung kein Jota glaubwürdiger und führt durchgehend zu absurden Verhaltensänderungen zwischen abgrundtiefem Hass und tiefster Freundschaft. Es ist, laut Drehbuch, eine dieser Freundschaften, die den Tod übersteht. Irgendwie.
Elphaba, inwischen geächtet als die Böse Hexe des Westens, lebt in einer riesigen Baumhöhle und versucht mit kindischen Aktionen, wie einem aufklärerischem Schriftzug in den Wolken, den Bewohnern von Oz zu sagen, dass der Zauberer von Oz ein Schwindler ist. Ihre Aktionen scheitern.
Glinda lebt in einem Palast in der Smaragdstadt. Sie posiert inzwischen als von allen verehrtes Symbol des Guten und steht kurz vor der Hochzeit mit dem gut aussehendem, tapferen und edlen Offizier Prinz Fiyero (Jonathan Bailey).
Während des Musicals gibt es etwas Kuddelmuddel mit Affen, die Flügel haben, Elphabas in einem Rollstuhl sitzende Schwester, undurchschaubaren Intrigen am Hof, in die irgendwie der über keinerlei Zauberkräfte verfügende Zauberer von Oz (Jeff Goldblum) und die über Zauberkräfte verfügende Madame Akaber (Michelle Yeoh) verwickelt sind. Die meisten dieser in ihrer Bedeutung für die Geschichte nicht nachvollziehbaren Aktionen füllen nur die Zeit bis zum Abspann. Irgendwann taucht Dorothy aus Kansas auf. Die Heldin von L. Frank Baums Kinderbuch „Der Zauberer von Oz“ und der gleichnamigen legendären Verfilmung von 1939 hat in „Wicked: Teil 2“ einen der schrägsten denkbaren Kurzauftritte. Er verrät nur, wann die Filmgeschichte spielt. Ansonsten sind Dorothy und ihre Begleiter, die immer nur teilweise im Bild sind, für die Geschichte von „Wicked: Teil 2“ egal.
Die Filmgeschichte, die auf Gregory Maguires revisionistischem und sich an eine erwachsene Leserschaft richtendem Roman „Wicked – Die Hexen von Oz“ und dem gleichnamigen, die Gesellschaftskritik des Romans weitgehend ignorierendem Broadway-Musical basiert, wird ziemlich schnell zu einer Abfolge unzusammenhängender Szenen, in denen Dinge passieren, während das Warum weitgehend nebulös bleibt. Die aus dem Musical bekannten Songs und die zwei neuen, von Stephen Schwartz geschriebenen Lieder „No Place Like Home“ und „The Girl in the Bubble“ sind nicht weiter erwähnenswert oder erinnerungswürdig. Das gilt auch für die beiden in diesem Zusammenhang mitreisenden Songs, die während der Pressevorführung von euphorischen Kennern des Bühnenstücks gleich mit Szenenapplaus bedacht wurden. Die Gesangsnummern, die in einem Musical gern der Auftakt für atemberaubende Massenszenen mit singenden und tanzenden Menschen sind, fügen sich in „Wicked: Teil 2“ nahtlos an die Gesangsnummern aus „Wicked“ an. Sie haben nichts von der Experimentierlust, die Jon M. Chu in seinem Musical „In the Heights“ zeigte. Auch in „Wicked: Teil 2“ orientiert er sich nicht daran, was heute möglich wäre, sondern was schon vor über achtzig Jahren in Musicals besser gemacht wurde.
Ansonsten wiederholt der insgesamt etwas dunklere, aber genauso CGI-lastige Film die Gesellschaftsvorstellungen und Bildmotive des ersten Films. Weil Chu beide Filme gleichzeitig drehte und sie zusammen eine Geschichte erzählen, war das zu erwarten. So bestätigen die Bilder wieder sattsam bekannte Stereotype, anstatt sie zu unterlaufen oder einer Neubetrachtung zu unterziehen.
Das gesagt, wird das Musical „Wicked: Teil 2“ sein Publikum finden. Der erste Teil spielte 750 Millionen US-Dollar Millionen ein. Die damaligen Zuschauer dürften zu einem großen Teil wieder besoffen vor Begeisterung ins Kino stürmen. Wem der erste Teil gefiel, wird auch der zweite Teil gefallen.

Wicked: Teil 2 (Wicked: For Good, USA 2025)
Regie: Jon M. Chu
Drehbuch: Winnie Holzman, Dana Fox
LV: Stephen Schwartz/Winnie Holzman: Wicked, 2003 (Musical); Gregory Maguire: Wicked – The Life and Times of the Wicked Witch of the West, 1995 (Wicked – Die Hexen von Oz)
mit Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Colman Domingo (Stimme, im Original), Peter Dinklage (Stimme, im Original)
Länge: 138 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Der Film läuft in verschiedenen Sprachfassungen im Kino.
–
Die Vorlage

Gregory Maguire: Wicked – Die Hexen von Oz
(übersetzt von Hans-Ulrich Möhring)
Hobbit Presse/Klett-Cotta 2024 (Filmausgabe)
544 Seiten
16 Euro
–
Deutsche Erstausgabe
Hobbit Presse/Klett-Cotta 2008
–
Originalausgabe
Wicked – The Life and Times of the Wicked Witch of the West
Regan Books, 1995
–
Hinweise
Moviepilot über „Wicked: Teil 2“
Metacritic über „Wicked: Teil 2“
Rotten Tomatoes über „Wicked: Teil 2“
Wikipdia über „Wicked: Teil 2“ (Film deutsch, englisch; Musical deutsch, englisch; Roman deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Jon M. Chus „Die Unfassbaren 2 – Now you see me“ (Now you see me 2, USA 2016) und der DVD
Meine Besprechung von Jon M. Chus „In the Heights: Rhythm of New York“ (In the Heights, USA 2021)
Meine Besprechung von Jon M. Chus „Wicked“ (Wicked, USA 2024)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB