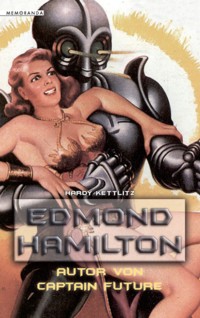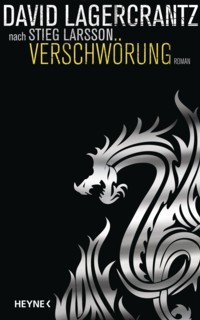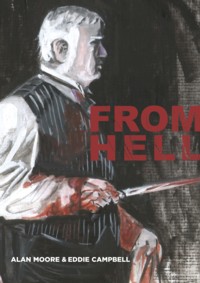Mark Petersons zweiter Kriminalroman mit Detective Sergeant Minter ist wie ein deutscher TV-Krimi. Und das ist kein Lob. Denn nach dem Mord in den ersten Minuten, beziehungsweise auf den ersten Seiten, gibt es Szenen über Szenen, von denen keine die Handlung erkennbar voranbringt, die aber die Zeit zwischen Mord und Aufklärung so lange füllen, bis in den letzten Minuten der Kommissar den Mörder überführt, weil die neunzig Minuten gleich um sind. Als Kritiker kann man jetzt gerade die Prämisse erwähnen („Eine verstümmelte Frauenleiche wird am Bahnhof in einem Koffer gefunden. Die Polizei ermittelt.“) oder fast die gesamte Handlung verraten, weil man erklärt, wie die einzelnen Szenen und Subplots miteinander oder eben nicht miteinander zusammen hängen.
Ein Beispiel gefällig? In Mark Petersons „Blood & Bone“ erfahren wir viel über die Frühstücksmoderatorin Abi Martin, ihre Sendung, ihre geplanten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung, später über ihren Freund und, noch später, über ihr Verhältnis zu ihrer dreizehnjährigen Tochter. Warum das irgendwie für die Mordermittlung von Minter und seinem Vorgesetzten DCI Tom Beckett, die herausfinden wollen, warum jemand in Brighton junge Frauen ermordet und verstümmelt, wichtig sein kann, erfahren wir nicht. Wir erahnen es noch nicht einmal. Peterson füllt hier einfach nur Seiten mit Banalitäten, die klassisches „Seiten, die der Leser überblättert“-Material sind. Auf Seite 159 verschwindet dann Morgans Tochter (sagt jedenfalls ihr Freund am Telefon) und endlich ergibt dieser Subplot, auch wenn die Ermittlungen der Polizei erst langsam anlaufen, einen Sinn.
Der geübte Krimileser vermutet natürlich einen Zusammenhang zwischen den Morden und der verschwundenen Dreizehnjährigen. Er plottet schon einmal weiter, während eine andere Polizeieinheit durch die normale Ermittlungsroutine bei einem verschwundenen Teenager geht, die mit dem Mordfall nichts zu tun hat, aber weitere Seiten füllt. Ach ja: bevor Vicky Reynolds, die Opferberaterin der Polizei, zu diesem Einsatz gerufen wird, trifft sie sich mit ihrer Mutter für ein Mutter-Tochter-Gespräch. Mit den Kriminalfällen hat das nichts zu tun. Es ist nur die klassische Szene, in der wir erfahren, was der Ermittler vor seiner Arbeit getan hat und die uninteressantes Füllmaterial ist.
In dem Moment haben wir schon über die Hälfte des Romans gelesen, aber in der Hauptgeschichte gibt es bislang außer mehreren Leichen, über die wir nichts wissen, und einem paranoid-schizophrenem Verdächtigen, der es aufgrund seiner Krankheit nicht gewesen sein kann, keinen Verdächtigen und auch keinen Ermittlungsansatz. Kurz: die Polizei stochert im Nebel, während wir schon dank der Rückblenden, die 1992 in Oxford beginnen, ahnen, dass Martin Blackthorn, ein Biochemie-Student, und John Slade, ein empathiefreier Zehnjähriger, wohl irgendetwas mit den Morden zu tun haben. Und, ja, sie haben etwas damit zu tun. Was von dem in der zweiten Hälfte des 350-seitigen Buches in epischer Langatmigkeit ausgebreiteten Entführungsfall nicht behauptet werden kann.
Die Serienmorde und deren Auflösung interessieren Peterson in der zweiten Romanhälfte nicht mehr sonderlich. So lässt er die Mordermittlungen mal schlappe fünfzig Seiten links liegen und, nachdem eine weiter Frauenleiche gefunden wird, beschäftigt er sich, nach drei Seiten, wieder, fünfzehn Seiten, mit irgendwelchen Ermittlungen über die Herkunft von Martins Tochter. Denn vielleicht hat ihr spurloses Verschwinden etwas mit ihrem wahren Vater, einem anonymen Samenspender, zu tun.
Wer jetzt glaubt, dass Mark Peterson die verschiedenen Handlungsstränge zu einer überraschenden Lösung zusammenführen wird, wird enttäuscht. Das Privatleben der Ermittler wird ja sowieso nur ausgebreitet, um im nächsten Roman weiter erzählt zu werden. Ein weiterer Subplot mit einem korrupten Kollegen von Minter hätte man, wie die gesamte Entführungsgeschichte streichen können. Immerhin ist die Jagd noch einem Serienmörder, der der Polizei täglich eine neue Leiche präsentiert, eigentlich romanfüllend.
Die wenigen Verbindungen zwischen den einzelnen Plots sind eher zufällig und gewollt; auch wenn man „Blood & Bone“ als typischen Polizeiroman mit mehreren, parallelen Fällen betrachtet. Das ist er, dank der konsequenten Missachtung der Polizeiarbeit, ebenfalls nicht. Das Ende ist dann holterdipolter und weil die Täter mit ihrer Überführung auch gleich das Zeitliche segnen, erfahren wir nichts Wesentliches über ihre Motive.
–
Mark Peterson: Blood & Bone
(übersetzt von Karen Witthuhn)
rororo, 2015
352 Seiten
10,99 Euro
–
Originalausgabe
A Place of Blood and Bone
Orion Books, 2013
„Blood & Bone“, Mord & Totschlag
Oktober 5, 2015Was sie schon immer über „Edmond Hamilton – Autor von Captain Future“ wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten
September 30, 2015Hardy Kettlitz, der Autor von „Edmond Hamilton – Autor von Captain Future“, lernte den Science-Fiction-Autor, wie viele Jugendliche Anfang der achtziger Jahre durch die japanische Zeichentrickserie „Captain Future“ kennen. In ihr kämpfen Curtis Newton, genannt Captain Future und ein echter Alleskönner (für die Jüngeren: „Iron Man“ Tony Stark, aber nicht so arrogant egozentrisch), und seine Vertrauten, das lebende, alles wissende Gehirn Professor Simon Wright, befreit von allen körperlichen Beschränkungen, Android Otho, der seine Gestalt verändern kann, Roboter Grag, der gerne ein Mensch wäre, und die wunderschöne, wunderschöne Joan Randall auf verschiedenen Planeten im Sonnensystem gegen Verbrecher. Durch die Serie erlebte Edmond Hamilton, der bereits 1977 verstorben war, eine Renaissance. Bastei-Lübbe veröffentlichte die „Captain Future“-Romane. Teilweise erstmals. Es gab Comics und etliche andere Merchandise-Artikel.
Dabei schrieb Hamilton (21. Oktober 1904 – 1. Februar 1977) nicht nur die „Captain Future“-Romane, sondern zahlreiche weitere Space Operas und Kurzgeschichten, die fast alle, mit einer weitgehenden Missachtung jeglicher wissenschaftlichen Plausibilität, zum Science-Fiction-Genre gehören. Das war und ist nicht Hohe Literatur, sondern Pulp, der allerdings Spaß macht und Jungs zu Leseratten macht.
In seiner lesenswerten Monographie stellt Kettlitz vor allem die Romane und Erzählungen von Hamilton, die auf Deutsch erschienen, kurz vor. Denn insgesamt schrieb Hamilton fast dreihundert Geschichten, die fast alle zuerst in einem der damals populären Magazine erschienen. Der Schwerpunkt von „Edmond Hamilton – Autor von Captain Future“ liegt dabei mit insgesamt gut achtzig Seiten auf Hamiltons bekanntestem Helden, dem schon genannten Captain Future. Zwischen 1940 und 1944 erschienen siebzehn „Captain Future“-Romane in den gleichnamigen Heften. Hamilton schrieb fünfzehn (zwei als Brett Sterling). 1945 und 1946 erschienen in „Startling Stories“ drei weitere „Captain Future“-Geschichten, von denen Hamilton zwei schrieb. 1950 und 1951 schrieb Hamilton, ebenfalls in „Startling Stories“, sieben kürzere „Captain Future“-Erzählungen. Kettlitz stellt sie alle kurz vor. Es gibt außerdem die ersten beiden Kapitel des ersten „Captain Future“-Romans, die Hamilton auf Wunsch seines Verlegers überarbeitete. Der ursprüngliche Text erschien erstmals 1971 in „Pulp“.
Es gibt ein im Februar 1975 mit Hamilton geführtes Interview, in dem er einige interessante Einblicke in das Geschäftsgebaren der Pulp-Magazine gibt. Es gibt eine ausführliche Bibliographie, die allerdings bei den Golkonda-Ausgaben der „Captain Future“-Geschichten schwächelt. Das liegt auch daran, dass „Edmond Hamilton – Autor von Captain Future“ erstmals 2003 als „Edmond Hamilton – Weltenzerstörer und Autor von Captain Future“ (SF Personality 13) erschien und 2012 für eine erweiterte und ergänzte Neuausgabe im Shayol Verlag (dem Vorläufer von Golkonda) veröffentlicht wurde. Und es gibt ein erstmals im Oktober 2011 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung erschienenes Essay von Dietmar Dath über Edmond Hamilton und Captain Future.
„Edmond Hamilton“ ist ein gewohnt liebevoll gestaltetes und sehr informatives Buch, das vor allem zum Blättern einlädt und, wenigstens bei mir, den Wunsch weckte, wieder einen „Captain Future“-Roman, die ja dank Golkonda in schönen Ausgaben wieder erhältlich sind, oder eine andere naive Weltraumoper zu lesen.
–
Hardy Kettlitz: Edmond Hamilton – Autor von Captain Future
Memoranda/Golkonda, 2015
208 Seiten
16,90 Euro
–
Hinweise
Meine Besprechung von Hardy Kettlitz‘ „Die Hugo-Awards 1953 – 1984“ (2015)
Wikipedia über Edmond Hamilton (deutsch, englisch) und Captain Future (deutsch, englisch)
Kurzkritik: Mark Billingham und sein Tom-Thorne-Roman „Der Manipulator“
September 29, 2015
Detective Inspector Tom Thorne von der Londoner Polizei ist zurück mit einem Fall, der für ihn nur aus schlechten Nachrichten besteht: Stuart Nicklin (bekannt aus dem zweiten Tom-Thorne-Roman „Die Tränen des Mörders“ [Scaredy Cat, 2002], der auch verfilmt wurde, und dem achten Tom-Thorne-Roman „Das Blut der Opfer“ [Death Message, 2007]) will der Polizei verraten, wo er eine weitere Leiche versteckt hat. Seine einzige Bedingung: Tom Thorne, der ihn damals verhaftete, soll ihn begleiten. Oh, und sein Mithäftling Jeffrey Batchelor soll ihn als objektiver Beobachter begleiten. Man weiß ja nicht, was Thorne und die anderen Polizisten vielleicht auf dem Weg vom Hochsicherheitsgefängnis zum Tatort und zurück anstellen.
Der Tatort liegt auf der einsam gelegenen Insel Bardsey (oder, auf walisisch: Ynys Enlli). Sie ist, wenn das Wetter gut ist, mit dem Schiff erreichbar. Handyempfang gibt es nur an wenigen Orten und sie hat keine der modernen Errungenschaften, die inzwischen in London auch in der billigsten Mietwohnung normal sind. Es ist noch wie in der guten alten Zeit, als man im Winter Eisblumen am Fenster sah.
Dort, so Nicklin, habe er sein erstes Opfer vergraben. Er war vor fünfundzwanzig Jahren einer der Zöglinge einer kurzlebigen Besserungsanstalt, die kurz nach seinem Verschwinden geschlossen wurde.
Thorne fragt sich, was Nicklin, der es genießt Menschen zu manipulieren, plant und wann er versucht zu fliehen.
Billinghams zwölfter Tom-Thorne-Roman „Der Manipulator“ lebt von dieser Spannung. Damit ähnelt er einem Western, der auf einen finalen Showdown zusteuert. Das ist aber auch das Problem des gut vierhundertfünfzigseitigem Romans. Denn nachdem man sich daran gewöhnt hat, dass die Geschichte auf Bardsey spielt und Nicklin bis zu seiner Flucht vor allem die Polizisten bei der Arbeit beobachtet, wartet man nur auf eben diesen Fluchtversuch. Bis dahin plätschert die Geschichte eher vor sich hin.
Insofern ist „Der Manipulator“, als Landpartie mit überschaubarem Personal, für langjährige Tom-Thorne-Fans eine willkommene Abkehr von dem gewohnten Muster und eine Wiederbegegnung mit einem altbekannten Bösewicht. Für Neueinsteiger wird der Roman, obwohl er problemlos zu verstehen ist und eine ziemlich überraschende Lösung hat, insgesamt zu handlungsarm und zu wenig thrillend sein, um wirklich zu begeistern.
Mark Billingham: Der Manipulator
(übersetzt von Irene Eisenhut)
Heyne, 2015
464 Seiten
12,99 Euro
–
Originalausgabe
The Bones beneath
Little, Brown (London), 2014
–
Hinweise
Upcoming4.me: Mark Billingham erzählt Wissenswertes über „Der Manipulator“ (Mai 2014)
Veronica Mars ermittelt „Mörder bleiben nicht zum Frühstück“
September 23, 2015Wer „Krimi“ mit „der Kommissar ermittelt den Mörder“ übersetzt, muss nicht weiterlesen. Denn in „Veronica Mars: Mörder bleiben nicht zum Frühstück“ ermittelt eine Privatdetektivin und einen Mordfall gibt es auch nicht. Es gibt nur eine vergewaltigte und fast tot geprügelte Frau, die behauptet, sich mehrere Monate nach der Tat an den Täter zu erinnern. Es ist Miguel Ramirez, der inzwischen von der Immigrationsbehörde nach Mexiko abgeschoben wurde und dort untergetaucht ist. Im Auftrag der Versicherungsgesellschaft des Nobelhotels Neptune Grand soll Veronica herausfinden, ob die Behauptung des Opfers, der neunzehnjährigen Grace Elizabeth Manning, stimmt. Veronica kennt ihre Schwester Meg Manning von früher (und wir aus der ersten und zweiten Staffel von „Veronica Mars“).
Natürlich nimmt Veronica Mars den Auftrag an und ebenso natürlich will sie den Täter finden, der nicht Miguel, sondern wahrscheinlich ein Hotelgast ist. Dummerweise gelang es dem Täter, Meg aus dem Hotel zu schmuggeln, ohne von einer der Überwachungskameras aufgenommen zu werden.
Veronica Mars begegneten wir erstmals in der von Rob Thomas erfundenen TV-Serie „Veronica Mars“ (USA 2004 – 2007), die immer noch eine sehr treue Fanbasis hat, die seit dem Ende der Serie nach weiteren Abenteuern von Veronica Mars verlangte. Deshalb entstand 2014 ein Spielfilm, in dem Kristen Bell wieder Veronica Mars spielte und viele Schauspieler wieder in ihren Serienrollen auftraten. Der Film wurde auch per Crowdfunding finanziert und die äußerst erfolgreiche Kampagne zeigte in harten Zahlen, wie sehr die Serienfans auch Jahre nach dem Ende der Serie mehr von Veronica Mars wollen.
Die von Serienerfinder Rob Thomas und Jennifer Graham geschriebenen Veronica-Mars-Romane spielen nach dem Spielfilm und erzählen die weiteren Abenteuer der in dem südkalifornischen Küstenort Neptune groß gewordenen Privatdetektivin, die nach ihrem Studium zurückkehrte und Partnerin in der Detektei ihres Vaters Keith Mars wurde.
Neptune ist als eine durch und durch korrupte Kleinstadt natürlich eine aktuelle Version von Dashiell Hammetts „Rote Ernte“-Ort Personville/Poisonville (bzw. Pissville in der deutschen Übersetzung) und Veronica Mars war in der TV-Serie die Teenie-Version des Hardboiled-Detektiv. Inzwischen ist sie kein auf die Schule gehender Teenager mehr. Aber Neptune ist immer noch ein Ort des Verbrechens und viele ihrer alten Schulfreunde, die mehr oder weniger große Auftritte in der TV-Serie hatten, leben noch in Neptune.
Diese umfangreiche Serienhistorie führt dann auch dazu, dass „Mörder bleiben nicht zum Frühstück“, der zweite Veronica-Mars-Roman, für meinen Geschmack etwas zu sehr mit Hinweisen auf die TV-Serie gefüttert ist. Natürlich begegnet Veronica ständig alten Bekannten, die auch immer wieder in Verbrechen verwickelt sind. Natürlich erinnert sie sich an ihre mehr oder weniger gemeinsame Vergangenheit und ihre damit zusammenhängenden alten Fälle. Das geschieht eher beiläufig in Nebensätzen und weckt bei allen, die die Serie gesehen haben, wohlige Erinnerungen. Aber Rob Thomas und Jennifer Graham schleppen hier mehr Ballast mit, als wir es von anderen Privatdetektiv-Krimis kennen. Ich rede jetzt nicht von dem Continental Op oder Philip Marlowe, die anscheinend keine Familie, Verwandschaft und Freunde hatten. Auch Spenser oder Matt Scudder haben als Einzelgänger ein überschaubares soziales Umfeld. Veronica hat Familie, Freunde, Freundinnen, Bekannte und, als altbekannten Gegner, Sheriff Lamb. Wobei dieser, weil gerade Wahlkampf ist, plötzlich eine aussichtsreiche Gegenkandidatin hat, die Keith Mars aus seiner Jugend kennt.
Das gesagt, ist „Mörder bleiben nicht zum Frühstück“ ein kurzweiliger PI-Krimi, der auch Krimifans gefallen dürfte, die die Serie nicht kennen.
Den Serienfans dürfte er auch gerade wegen der Referenzen zur Serie gefallen.
–
Rob Thomas/Jennifer Graham: Veronica Mars: Mörder bleiben nicht zum Frühstück
(übersetzt von Sandra Knuffinke und Jessika Komina)
script5, 2015
368 Seiten
14,95 Euro
–
Originalausgabe
Mr. Kiss and Tell
Vintage Books, 2015
–
Hinweise
Facebook-Seite zu den Veronica-Mars-Romanen
Word & Film: Kurzes Interview mit Jennifer Graham (25. März 2014)
PopBytes: Längeres Interview mit Jennifer Graham (31. März 2014)
Thrilling Detective über Veronica Mars
Englische Veronica-Mars-Fanseite
Meine Besprechung von Rob Thomas’ „Veronica Mars“ (Veronica Mars, USA 2014)
Meine Besprechung von Rob Thomas’ „Veronica Mars“ (Veronica Mars, USA 2014) (DVD-Besprechung)
„Tag X: Wer ermortete den Präsidenten?“ am 22. November 1973 in Dallas?
September 21, 2015Das Spiel mit alternativen Geschichtsverläufen ist für Science-Fiction-Fans und Historiker ein alter Hut, der als „Was wäre wenn?“-Frage immer wieder Spaß macht. Was wäre, wenn Adolf Hitler ein erfolgloser Künstler mit seltsamen Ideen geblieben wäre? Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte?
Was wäre, wenn das Attentat auf den US-Präsidenten in Dallas nicht 1963, sondern zehn Jahre später geschehen wäre. John F. Kennedy wäre dann in jedem Fall nicht mehr Präsident der USA gewesen. Aber wer wäre Präsident? Wie hätte sich die Geschichte seit dem 22. November 1963 entwickelt?
Das fragten sich die Szenaristen Fred Duval und Jean-Pierre Pécau in ihrem von Colin Wilson gezeichneten Comic „Tag X: Wer ermordete den Präsidenten?“. Allerdings verlegen sie eigentlich nur das Attentat auf den Präsidenten um zehn Jahre. Statt Kennedy wird Richard Nixon erschossen und es gibt einen ordentlichen Kuddelmuddel zwischen verschiedenen Geheimdiensten und interessierten Gruppierungen. Einige Kleinigkeiten, vor allem natürlich das US-Engagement in Vietnam, gestalteten sich anders, aber sie bleiben der weitgehend austauschbare Hintergrund, vor dem sich die Geschichte des Mordkomplotts abspielt, das wie eine Wiederauflage der sattsam bekannten Verschwörungstheorien zum Kennedy-Mord wirkt. Zwischen anderen Alternativweltgeschichten (im Comicbereich ist „Watchmen“ natürlich der heilige Gral) kommt diese Geschichte dann doch arg bieder daher.
„Wer ermordete den Präsidenten?“ ist der Auftakt von weiteren Comics, die mit der Idee alternativer Geschichtsverläufe spielen. Der zweite Band, „Die Kennedy-Gang“ ist für Oktober angekündigt. In Frankreich sind bereits 18 Bände erscheinen, was bedeutet, dass die Macher irgendetwas richtig machen und was mich hoffen lässt, dass die nächsten Bände intellektuell gewagter sind.
–
Fred Duval/Jean-Pierre Pécau (Szenario)/Fred Blanchard (Mithilfe)/Colin Wilson (Zeichnungen): Tag X: Wer ermordete den Präsidenten?
(übersetzt von Horst Berner)
Panini, 2015
56 Seiten
13,99 Euro
–
Originalausgabe
Jour J – Qui a tué le président?
Guy Delcourt Productions, 2011
Keine „Verschwörung“. Mikael Blomkvist und Lisbeth Salander sind zurück
September 18, 2015Dass ich nicht der große Stieg-Larsson-Fan bin, dürfte bekannt sein (siehe hier, hier und hier).
Dass ich keine Probleme habe, wenn andere Autoren neue Romane mit bekannten Figuren schreiben, stört mich auch nicht.
Und David Lagercrantz wurde von den Erben des am 9. November 2004 verstorbenen Stieg Larsson, seinem Vater und seinem Bruder, beauftragt, einen weiteren Roman mit den bekannten Charakteren und der von Larsson etablierten Welt zu schreiben. Immerhin haben die drei „Millennium“-Romane von Larsson, die erst nach seinem Tod erschienen, sich weltweit millionenfach verkauft. Sie wurden erfolgreich verfilmt. Der erste Band sogar zweimal. Es gibt Comics, die von der renommierten Krimi-Autorin Denise Mina geschrieben wurden. Larssons Freundin Eva Gabrielson, die nicht mit ihm verheiratet war, inzwischen eine Biographie über ihre Jahre mit Stieg Larsson schrieb und weil es kein Testament gab, ncht zu seinen Erben gehört, behauptete, das Manuskript eines vierten Romans von Stieg Larsson auf einem Computer zu haben und sie es auch fertig schreiben und veröffentlichen wolle. Bis jetzt ist das nicht geschehen.
Und es gab, selbstverständlich, einige Stieg-Larsson-Parodien.
Angesichts der immer noch vorhandenen Nachfrage nach den Romane von Stieg Larsson war es nur eine Frage der Zeit, bis, wie auch bei anderen verstorbenen Autoren (ad hoc Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Ian Fleming), die Erben einen anderen Autor beauftragen, einen weiteren Roman zu schreiben. Sie beauftragten David Lagercrantz mit der Aufgabe. Und sie wollen, dass die Einnahmen aus diesem Roman in eine Stiftung für linke Projkete fließen.
Lagercrantz erledigt seine Aufgabe auch ganz zufriedenstellend. Immerhin war auch Stieg Larsson kein großartiger Stilist. Dafür füllte er viele Seiten mit teils unerheblichen Details und vollkommen überflüssigen Subplots. Das war schon in seinem ersten Roman „Verblendung“ so. In „Vergebung“ erzählte er dann auf gut achthundertfünfzig Seiten eine Geschichte, die ein erzählökonomischerer Autor als zweiseitigen Epilog von „Verdammnis“ erledigt hätte. Bei den Verfilmungen wurde dann beherzt und problemlos viel erzählerisches Fett weggeschnitten.
Das wird bei „Verschwörung“ etwas schwieriger sein. Der nur sechshundertseitige Roman spielt, auch wenn kein markantes politisches, kulturelles oder gesellschaftliches Ereignis und kein Jahr genannt wird (es wird zwar auf Seite 317, als einziges konkretes Datum, „Mittwoch, der 22. November“ genannt, aber diese Kombination gibt es in diesem Jahrzehnt nur 2017), ungefähr ein Jahrzehnt nach Larssons Romanen. Also ungefähr jetzt. In der Gegenwart des Jahres 2015. In der Nach-Snowden-Zeit, obwohl er sich liest, als sei er in der Prä-Snowden-Zeit geschrieben worden.
Enthüllungsjournalist Mikael Blomkvist erfährt, dass Frans Balder, der führende Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, zurück in Stockholm ist und er verfolgt wird. Blomkvist hat zwar keine Ahnung von Künstlicher Intelligenz, aber anscheinend interessiert sich auch die beziehungsgestörte Hackerin Lisbeth Salander, die er seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, für Balder.
Als Blomkvist Balder besucht, der von zwei Polizisten wegen einer geheimnisvollen, aber sehr ernst zu nehmenden Todesdrohung (die die NSA aufgeschnappt hat) bewacht wird, wird gerade, mitten in der Nacht, ein Anschlag auf den Wissenschaftler verübt. Balder stirbt. Sein autistischer Sohn mit zwei Inselbegabungen (Zahlen, vor allem Primzahlen, und fotorealistische Zeichnungen) überlebt. Der achtjährige August könnte sie zum Mörder führen.
Zur gleichen Zeit hat Lisbeth Salander sich schon in den Computer der NSA eingehackt und wichtige Dokumente gestohlen, weshalb die NSA den unbekannten Hacker jagt.
Durch einige Umstände, die uns hier nicht genauer interessieren müssen, rettet Salander das Leben von August und versteckt sich mit ihm in einer einsamen Hütte.
Und viel mehr von der Handlung zu verraten, würde das gesamte Buch spoilern, weil die Geschichte von „Verschwörung“ sich über viele hundert Seiten in ominösen Andeutungen ergeht. Geheimdienste, ein Konzern, der mit Geheimdiensten und Gangstern zusammenarbeitet, Forschungen im Bereich Künstlicher Intelligenz, die weltweite Überwachung, die Polizei und Salanders Familie haben alle irgendwie damit zu tun. Sowieso tauchen viele alte Bekannte aus den vorherigen Büchern auf, weshalb sich „Verschwörung“ auch wie ein „Schön, dass wir uns wiedersehen“-Familientreffen liest. Es gibt viele Andeutungen auf den nächsten Roman, der, wie „Verschwörung“, in einem Paralleluniversum spielt, das wir so ähnlich auch großen Comic-Epen kennen, in denen alle wichtigen Figuren miteinander verwandt und verschwägert sind und sie einen epischen Familienzwist austragen.
Das unterscheidet Lagercrantz dann eindeutig von Larsson. In seinen Romanen war die Realität der Hintergrund, vor dem er seine immer wieder überraschend umständlich und dadurch oft sehr spannungsarme Geschichte entfaltete. Er benutzte die Romane, um über seine Themen zu schreiben und weil es ihm wichtig war, schrieb er Seiten darüber. Er lenkte damit die Aufmerksamkeit des Lesers auf Themen, die in der Gesellschaft damals nicht oder nur wenig beachtet wurden. Und Salanders selbstverständlicher Einsatz von Computern, dem Internet und modernen Überwachungstechniken war vor zehn Jahren in einem Kriminalroman noch neu. Damit hatten seine Romane und wie er Stimmungen und Entwicklungen aufgriff, schon etwas prophetisches.
Bei Lagercrantz ist es genau umgekehrt. Er schafft es, einen Roman über die NSA zu schreiben, ohne auch nur einmal Edward Snowden zu erwähnen. Bei ihm wird die gesamte Diskussion über globale Überwachung, die uns seit dem Sommer 2013 begleitet, vollkommen ignoriert. Sogar als Lisbeth sich in den NSA-Computer einhackt, was bei dem zuständigen Beamten zu einer durchaus gerechtfertigten Panikattacke führt, wird Snoden und das durch ihn veränderte Selbst- und Fremdbild des Geheimdienstes nicht erwähnt. Es ist, als habe es nie einen Whistleblower gegeben und die NSA und der schwedische Geheimdienst besteht in „Verschwörung“ eigentlich nur aus netten Menschen, die sich aus altruistischen Motiven um unser Wohlergehen und unsere Privatsphäre sorgen.
Für einen Polit-Thriller, und „Verschwörung“ will irgendwo in diesem Genre mitschwimmen, ist dieses vollständige Ignorieren der Realität der Todesstoß, der die gesamte Geschichte zu einem unglaubwürdigem Gedankenkonstrukt degradiert.
Das gesagt, dürfte „Verschwörung“, auch wenn Womanizer Mikael Blomkvist weniger Kaffee trinkt (dafür ist sein Bierkonsum gestiegen) und sein Sexualleben nicht mehr existent ist (was allerdings auch daran liegt, dass er in den fünf Tagen, in denen die Romangeschichte spielt, kaum zum Schlafen kommt, er den Tod eines jungen Kollegen seelisch verarbeiten muss, seine heißgeliebte Zeitschrift „Millennium“ wieder einmal kurz vor dem Konkurs steht und er von Kollegen als twitterfreies Relikt aus dem letzten Jahrhundert angegriffen wird), den Stieg-Larsson-Fans im Modus „neuer Autor, alte Teile“ gefallen.
–
David Lagercrantz: Verschwörung
(übersetzt von Ursel Allenstein)
Heyne, 2015
608 Seiten
22,99 Euro
–
Originaltitel
Det some ine dödar oss
Norstedts, Stockholm, 2015
–
Hinweise
Meine Besprechung von Stieg Larssons „Verblendung“ (Buch und Film)
Meine Besprechung von Stieg Larssons „Verdammnis“ (Buch und Film)
Meine Besprechung von Stieg Larssons „Vergebung“ (Buch und Film)
Krimi-Couch über Stieg Larsson
Wikiepedia über Stieg Larsson (deutsch, englisch)
Philip Kerr, viel Fußball, ein Mord und „Der Wintertransfer“
September 16, 2015Sogar mir als Mitglied der Fußball-ist-mir-egal-Fraktion (außer natürlich wenn es um Bürgerrechte, Polizeirepression, Gewalt und Korruption geht) fällt auf, dass Fußball einerseits ein Milliardengeschäft ist, andererseits aber kaum Romane über Fußball geschrieben werden. Dabei ist das Spiel und sein Umfeld doch ein ideales Biotop für spannende Geschichten.
Jetzt hat Philip Kerr mit „Der Wintertransfer“ eine im Fußballmilieu spielende Detektivgeschichte geschrieben. Scott Manson ist Co-Trainer beim Premier-League-Verein London City, der inzwischen dem ukrainischen Milliardär Viktor Jewegenowitsch Sokolnikow gehört. Nach Medienberichten ist er ein Oligarch mit mehr als guten Kontakten zum Organisierten Verbrechen, weshalb das mitten auf dem Spielfeld des Vereins ausgehobene Grab auch als ein Signal an Sokolnikow, von Russenmafiosi an Russenmafiosi, verstanden wird. Auch wenn es als Warnung arg theatralisch daherkommt und in dem Grab ein Bild von Joao Zarco, dem Trainer des Vereins liegt. Zarco ist in der Öffentlichkeit vor allem als kein Blatt vor den Mund nehmende Choleriker bekannt. Aber er ist auch ein guter Trainer und ein Freund von Manson.
Kurz darauf ist er tot. Er wurde in einem abgelegenen Raum des Stadions zu Tode geprügelt. Täter und Motiv sind vollkommen unklar.
Sokolnikow bittet Manson, den Mörder zu suchen. Denn in so einem Fußballverein gibt es viele Geschichten, von denen die Polizei und die Öffentlichkeit (via einem Informanten bei der Polizei) nichts erfahren muss.
Außerdem ist gerade der titelgebende Wintertransfer, eine Zeit von wenigen Wochen, in denen Vereine wie blöde Spieler kaufen und verkaufen. Da würde negative Presse sich negativ auf die Verkaufspreise auswirken.
Die meisten werden Philip Kerr über seine Bernie-Gunther-Romane, die sogenannte „Berlin Trilogie“ (oder „Berlin Noir“), die zwischen 1989 und 1991 erschien, kennen gelernt haben. Nach einer fünfzehnjährigen Pause schreibt Kerr inzwischen wieder regelmäßig neue Gunther-Romane die während und nach der Hitler-Diktatur spielen und die, als Hardcover bei Wunderlich (zuletzt „Wolfshunger“) und als Taschenbuch bei rororo (dort erscheint die Taschenbuch-Ausgabe von „Wolfshunger“ Ende November) erscheinen. Ich lernte Kerr über seine ab 1992 erschienenen Einzelromane, wie „Das Wittgenstein-Programm“, „Game Over“ und „Esau“, kennen. Es sind gut recherchierte Thriller, in denen Kerr Fakten und Fiktion gekonnt miteinander verbindet und von Buch zu Buch, manchmal auch in Richtung Science-Fiction gehend, zwischen den verschiedenen Thriller-Subgenres wechselt.
Das gilt auch für „Der Wintertransfer“, der von seiner Struktur her ein klassischer, gut konstruierter Rätselkrimi ist, bei dem die Spuren und falschen Spuren gut gelegt sind.
Dazu kommen viele Informationen über Fußball, die oft monologisierend präsentiert werden. Manchmal weil ein Trainer oder eine andere wichtige Person gerade eine Ansprache hält oder jemand anderes, beispielweise einer nicht-fußballbegeisterten Polizistin, etwas erklären will. Das hat oft die Qualität eines Zeitungskommentars, der sich vor allem an den Leser, mal als Fußballfan, mal als Nicht-Fußballfan, richtet und so in der Realität oft nicht gesprochen würde.
Über diese Fußballfakten und Spielbeschreibungen (so gibt es kurz vor der Auflösung ein in jeder Phase detailliert beschriebenes Spiel gegen West Ham, das Manson, abgesehen von einem Blick auf die Gästeliste, nicht einen Schritt näher an die Lösung, aber seine Mannschaft vielleicht näher an den Ligapokal bringt) gerät dann der Rätselplot immer wieder in den Hintergrund. Aber so habe ich genug über Fußball erfahren, um bei den nächsten Gesprächen mit Hintergrundwissen zu punkten.
Und Kerr, selbst ein bekennder Fan, hat Gefallen an Manson und dem Fußballmilieu gefunden. In England sind bereits zwei weitere Manson-Romane erschienen.
–
Philip Kerr: Der Wintertransfer
(übersetzt von Axel Merz)
Tropen, 2015
432 Seiten
14,95 Euro
–
Originalausgabe
January Window
Head of Zeus, London, 2014
–
Hinweise
Homepage von Philip Kerr
Krimi-Couch über Philip Kerr (nicht so aktuell)
Wikipedia über Philip Kerr (deutsch, englisch)
Französische Verbrechen mit Léo Malet und Jérémie Guez
September 14, 2015Vor einigen Wochen sagte ich zu einem Freund: „Warum soll ich ein Buch von Léo Malet lesen? Der ist schon seit fast zwanzig Jahren tot und Neuausgaben gibt es keine.“
Nun, tot ist Malet immer noch, aber mit „Das Leben ist zum Kotzen“ gibt es eine Neuausgabe von einem seiner alten Romane (mit einem informativem Nachwort von Tobias Gohlis) und damit auch einen guten Grund, einen Malet zu lesen. Malet – für alle, die sich verzweifelt fragen, wer dieser Malet denn ist – ist vor allem bekannt für seine derzeit vor allem antiquarisch erhältliche Nestor-Burma-Privatdetektivserie, von denen jeder Roman in Paris in einem anderen Arrondissement in Paris spielt.
In „Das Leben ist zum Kotzen“, dem ersten Band seiner zwischen 1947 und 1949 entstandenen Schwarzen Trilogie (Band zwei ist „Die Sonne scheint nicht für uns“, Band drei ist „Angst im Bauch“), erzählt Malet die Geschichte von Jean Fraiger. Er ist der Kopf einer kleinen Verbrecherbande, die ihren ersten Überfall auf einen Lohngeldtransporter quasi im Auftrag streikender Bergarbeiter begeht. Dummerweise gerät der einfache Überfall etwas außer Kontrolle. Der Fahrer wird verletzt. Der Beifahrer wird erschossen. Er ist der Vater von Gloria, der Frau von Lautier, was kein Probleme wäre, wenn Fraiger, der ihren Vater erschoss, nicht unsterblich in sie verliebt wäre.
Und die streikenden Arbeiter wollen nach dem aus dem Ruder gelaufenem Überfall auch nicht das Geld. Sie wollen es vollständig verbrennen.
Kein Wunder, dass Fraiger meint: „Das Leben ist zum Kotzen.“
Aber er und seine Bande machen weiter. Dass das kein gutes Ende nimmt, können wir uns denken. Immerhin ist der Roman schon vor über 65 Jahren geschrieben worden und damals war es eine eherne (heute immer noch gültige) Regel, dass die Verbrecher für ihren Taten büßen müssen. Und dass Gloria keinen guten Einfluss auf den Ich-Erzähler Fraiger hat, können wir uns ebenfalls denken und dennoch wollen wir wissen, wie Fraiger sich immer weiter in Schuld verstrickt. Das erzählt Malet auf knapp 140 Seiten, die sich wie die Vorlage für einen französischen Kriminalfilm aus den fünfziger Jahren lesen. Mit Simone Signoret oder Jeanne Moreau als verführerische Gloria. Jean Gabin ist natürlich auch dabei. Und vielleicht Jean-Paul Belmondo als Fraiger. Und so legt sich über die Geschichte, die etwas unglücklich zwischen Sozialdrama, verquerer Liebesgeschichte (aus heutiger Sicht) und knallhartem Gangsterdrama schwankt, die Patina der Vergangenheit.
–
Jérémie Guez‘ Debüt „Paris, die Nacht“ erinnert überhaupt nicht an die klassischen französischen Kriminalfilme. Immerhin spielt der ebenfalls angenehm kurze Roman, der ebenfalls „Das Leben ist zum Kotzen“ heißen könnte, im heutigen Paris. Bei einem ihrer abendlichen Streifzüge entdecken die beiden jungen kleinkriminellen Gelegenheitsdealer Abraham und Goran einen illegalen Spielsalon, in dem Verbrecher zocken. Sie halten es für eine geniale Idee, die Verbrecher auszurauben. Denn die können nicht zur Polizei gehen.
Dass das dann doch keine so grandiose Idee war, erfahen sie kurz darauf. Denn die Gangster wollen ihr Geld zurückhaben. Und im Gegensatz zur Polizei müssen sie sich nicht an das Gesetz halten.
Guez war, als sein Debüt in Frankreich 2010 erschien, 22 Jahre und so überzeugt „Paris, die Nacht“ vor allem als Talentprobe, die er besser nicht im Präsens geschrieben hätte. Allzu oft stockt der Lesefluss, weil ich immer wieder nach zwei, drei, vier Sätzen bemerkte, dass ich in Gedanken mal wieder in der vertrauten, aber hier falschen Zeitform war. Dass sein Debüt den bekannten Genrepfaden folgt, kann ihm nicht wirklich vorgeworfen werden. Immerhin schrieb er nicht, wie andere Debütanten, eine langweilige Selbstbespiegelung und die Geschichte seiner ersten großen Liebe. Frauen haben in „Paris, die Nacht“ noch nicht einmal eine Nebenrolle. Und er verzichtet auf die aus anderen Gangstergeschichten bekannten Klischees über die Banlieue, das Migrantenviertel Belleville und die chancenlosen Migrantenkinder. Hier ist jeder für sein Schicksal verantwortlich. Deshalb buddeln sich der Ich-Erzähler Abraham, sein bester Freund Goran und ihre Freunde, die alle wirklich nicht die Hellsten sind, ohne fremde Hilfe ihr Grab.
–
Léo Malet: Das Leben ist zum Kotzen
(übersetzt von Sarah Baumfelder und Thomas Mittelstädt)
(mit einem Nachwort von Tobias Gohlis)
Nautilus, 2015
160 Seiten
14,90 Euro
–
Deutsche Erstausgabe
Nautilus, 1987
–
Originalausgabe
La vie est dégueulasse
S. E. P.E./Editions du Scorpion, 1948
–
Jérémie Guez: Paris, die Nacht
(übersetzt von Cornelia Wend)
(mit einem Nachwort von Thekla Dannenberg)
Polar, 2015
152 Seiten
12,90 Euro
–
Originalausgabe
Paris la nuit
La Tengo, 2011
–
Hinweise
Wikipedia über Léo Malet (deutsch, französisch) und Jérémie Guez
Krimi-Couch über Léo Malet
Meine Besprechung von Jalil Lesperts „Yves Saint Laurent“ (Yves Saint Laurent, Frankreich 2013) (Guez ist einer der Drehbuchautoren)
Kurzkritik: Sebastian Thiel: Sei ganz still
September 9, 2015„Ein Noir-Krimi“ steht auf dem Cover von Sebastian Thiels „Sei ganz still“ und natürlich löst das bei mir einen sofortigen, äußerst wohlwollenden Lesereflex aus. Nach der Lektüre empfand ich den Krimi gar nicht als so Noir, sondern eher als ziemlich normalen Hardboiled-Privatdetektiv-Krimi vor einem ungewohnten Hintergrund. Denn die Geschichte spielt 1938 in Deutschland.
Friedrich Wolf sticht seit einigen Wochen in einem Strafgefangenenlager Torf. Er war früher Polizist. Einer von der altmodisch-harten Sorte: ein Trinker, ein Stammgast in den Freudenhäusern, ein Schläger, aber auch einer, der die Bösewichter schnappte. Und, immerhin ist er unser Held, integer. Mit den Nazis, der SS, den Mitläufern und den Hofschranzen hat er nichts zu tun. Deshalb sitzt er auch im Lager, bis Ernst Kampa, ein hochrangiger SS-Arzt, ihn herausholt, neu einkleidet, ihm ein Bündel Geld gibt und beauftragt, seine verschwundene Verlobte Charlotte Rickert, die er demnächst heiraten will, zu finden. Sie ist Wolfs altem Revier, in Düsseldorf, untergetaucht.
Wolf frischt als Privatdetektiv ohne Lizenz zuerst einmal seine alten Kontakte aus dem Milieu auf und schnell hat er eine Spur.
Geübten Krimilesern verrate ich sicher kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Kampa mit gezinkten Karten spielt. Immerhin gehört das seit den Tagen von Dashiell Hammett und Raymond Chandler zum festen Inventar einer Privatdetektiv-Geschichte und eine solche Geschichte erzählt Sebastian Thiel in seinem spannenden Krimi, der dank des Handlungsortes und der Handlungszeit mit einigen überraschenden Wendungen aufwarten kann. Inwiefern er in den Details historisch korrekt ist (Gab es 1938 noch eine so offen agierende Halb- und Unterwelt? Konnte ein Bordell so bekannt sein?), weiß ich nicht. Aber die Aussortierung von lebensunwertem Leben und die medizinischen Versuche an Kindern gab es (und in einem Nachwort hätte Thiel als sinnvolle Zusatzinformation noch etwas genauer auf die historischen Hintergründe eingehen können). Das Klima der Verunsicherung ist, auch wenn es ein eher austauschbarer Hintergrund ist, den wir von in totalitären Gesellschaften spielenden Krimis kennen, gut getroffen und natürlich muss man bei einem deutschen Krimi dankbar sein, wenn der Protagonist ein moralisch ambivalenter Ermittler ohne Familienanhang ist und die Halb- und Unterwelt als das natürliche Umfeld des Ermittlers gezeigt wird.
Das klingt jetzt vielleicht etwas negativ. Dabei hat mir „Sei ganz still“ gut gefallen. Es ist ein flott geschriebener PI-Krimi, der auch wegen des actionhaltigen Endes gut verfilmt werden könnte.
–
Sebastian Thiel: Sei ganz still
Gmeiner, 2015
288 Seiten
10,99 Euro
–
Hinweise
Homepage von Sebastian Thiel
Histo-Couch: Interview mit Sebastian Thiel über „Sei ganz still“
Kurzkritik: Jutta Vahrson: Mord im Farnhaus
September 8, 2015Nach den beiden Wälzern „Tage der Toten“ und „Das Kartell“ über den Drogenkrieg der USA in Südamerika, muss ich einige kurze Bücher lesen (Ah, das ist eine der Schönheiten des Bloggens! Jeder Redakteur hätte diesen Satz sofort gestrichen, weil er nichts mit der nun folgenden Rezension zu tun hat und weil der Kritiker objektiv kritisieren soll und da ist es egal, was er vorher und nachher gelesen hat.).
Jedenfalls gibt es in den nächsten Tagen einige Besprechungen von Krimis, die alle weniger als vierhundert, dreihundert oder zweihundert Seiten haben. Beginnen wir mit „Mord im Farnhaus“ von Jutta Vahrson, einem fast schon klassischen Landhauskrimi. Auch wenn dieses Landhaus nicht in England, sondern in Neuseeland steht und es auch kein Landhaus, sondern eine ziemliche Bruchbude im Wald am Arsch der Welt ist, die von der Ich-Erzählerin Renate Ute Anke Schlingensiel, kurz Reni, zu einer Unterkunft für Rucksacktouristen aufgehübscht wird. Eigentlich überlässt sie den Rucksacktouristen das Renovieren und verlangt dafür noch Geld (Ein Plan, der mir gefällt.).
Reni ist auch keine Miss Marple, sondern eine deutlich jüngere, mäßig erfolgreiche Krimiautorin mit Agatha-Christie-Spleen, die ihr Cottage in England verlässt. Die angedrohte Mieterhöhung hätte sie nicht bezahlen können und die Nachricht, dass ihre Tante ihr ein Haus vermachte, ließen sie die Koffer packen. Das Haus, das „Sand Castle“, ist dann, wie gesagt, doch nicht so prächtig und die Frauenleiche, die, als Begrüßungsgeschenk, vor ihrem neuen Heim liegt, trägt auch nicht dazu bei, ihre Stimmung zu heben. Auch wenn der örtliche Doktor, im Hauptberuf Tierarzt, etwas von einem natürlichen Tod faselt.
Jedenfalls hat sie mit ihren Hostelgästen, darunter ein hilfsbereiter Mann im zeugungsfähigen Alter (sehr, sehr verdächtig!), der Schwester der Toten und dem halben Dorf schnell genug Personal für einen veritablen Rätselplot versammelt. Auch wenn unklar ist, ob Dora-May, die Pächterin von Renis Haus, ermordet wurde.
Als Reni erfährt, dass ihre Tante irgendwo auf dem großen Grundstück einen Schatz versteckt hat, träumt sie von einem Ausweg aus ihrer finanziellen Misere und sie hat auch eine sehr genaue Idee weshalb Dora-May und vielleicht sogar ihre Tante ermordet wurde.
Ihr ahnt es: „Mord im Farnhaus“ ist ein richtig altmodischer, vergnüglich kurzweiliger Rätselkrimi mit einer leicht verpeilten Amateurermittlerin und viel Agatha Christie, die am 15. September ihren 125. Geburtstag hat. Und weil bei einem Rätselkrimi jedes Wort schon die Lösung, also den Mörder (Nein, es ist nicht der Butler. Das Farnhaus hat keinen Butler.), verraten kann, sage ich nur: hat gefallen!
–
Jutta Vahrson: Mord im Farnhaus
2015
235 Seiten (ungefähr)
2,99 Euro
(ist ein Ebook und hier ist der Amazon-Link)
–
Hinweis
Homepage von Jutta Vahrson
Am Ziel: „Das Kartell“ von Don Winslow
August 26, 2015
Nach der vorbereitenden Lektüre mit zwei kurzweiligen Neal-Carey-Romanen („London Undercover“ und „China Girl“) und seiner siebenhundertseitigen, 2005 erschienenen Chronik des US-Drogenkrieges „Tage der Toten“ bin ich mit „Das Kartell“, dem neuesten Roman von Don Winslow, der fast zeitgleich in den USA und Deutschland erschien, am Ziel von meinem kleinen Don-Winslow-Lesemarathon.
Zehn Jahre nach „Tage der Toten“ erzählt Winslow in „Das Kartell“ die Geschichte von DEA-Fahnder Art Keller und seiner Nemesis, dem mexikanischen Drogenboss Adán Barrera, weiter und widmet sich den Jahren zwischen 2004 und 2012 (mit einem 2014 spielendem Epilog), in denen der Drogenkrieg zunehmend brutaler geführt wurde und die von den Drogenkartellen verursachte Gewalt in Mexiko ungeahnte Ausmaße erreichte.
Am Anfang von „Das Kartell“ gelingt es Barrera, der am Ende von „Tage der Toten“ verhaftet wurde und vor einem US-Gericht angeklagt werden soll, von dem US-Gefängnis in ein mexikanisches Gefängnis überstellt zu werden, aus dem er schnell flüchtet. Art Keller, der sich in ein Kloster zurückgezogen hat, nimmt wieder seine Arbeit als Drogenfahnder auf. Er kennt Barrera am besten und er will ihn zur Strecke bringen.
Die ersten Seiten des über achthundertseitigem Roman lesen sich aufgrund der Ausgangslage eher wie ein klassischer Thriller mit einem klar definiertem Helden und einem ebenso klar definiertem Bösewicht. Das ändert sich im Verlauf des Romans, der in erster Linie eine chronologische Chronik des Anti-Drogenkampfes der USA in Mexiko in den vergangenen zehn Jahren ist und die sich liest, als sei sie direkt von den Schlagzeilen abgeschrieben worden. Diese Struktur, die eine Mischung aus den Titelseiten der Zeitungen und des episodischen Serienfernsehens (das im Rahmen eines daily struggle nicht mehr auf ein festes Ende angelegt ist und daher auch immer wieder mäandert und die Lösung des Konflikts endlos vor sich hin schiebt) ist, führt auch dazu, dass Keller und Barrera immer wieder für Dutzende von Seiten aus der Geschichte verschwinden und dass es breit gezeichnete Subplots gibt, die den Hauptplot (nämlich den Kampf zwischen Keller und Barrea) keinen Millimeter voranbringen.
So gibt es von Seite 383 bis Seite 430 das Kapitel „Journalisten“, das die Arbeit und das Privatleben von einigen Journalisten in Ciudad Juárez, einem Ort mit inzwischen trauriger Berühmtheit, schildert und der Beginn eines eigenständigen Plots ist, der mit Art Keller und Adán Barrera eigentlich nichts zu tun hat. Natürlich geht es in diesem Kapitel auch um die Banden- und Drogenkriminalität, aber jetzt wird der Drogenkrieg plötzlich aus einer Außenperspektive (nämlich der von ehrlichen Menschen, die weder Drogenhändler noch Polizisten sind) geschildert. Das ist nicht uninteressant, aber man hätte das Kapitel auch einfach streichen können, ohne am restlichen Text irgendetwas ändern zu müssen. Solche Episoden, die manchmal zu größeren Subplots werden, gibt es in „Das Kartell“ mehrere und sie tragen auch dazu bei, dass sich mit zunehmender Lektüre ein Gefühl der Erschöpfung einstellt.
Das spiegelt natürlich auch die Vergeblichkeit des Antidrogenkrieges und die zunehmende Erschöpfung von Keller und Barrera wieder. Aber literarisch erinnert dieses Programm dann an die unsäglich „totquatschen, bis alle zustimmen“-Politik, die nicht durch Qualität (die durchaus vorhanden sein kann), sondern nur durch Quantität beeindrucken will.
Wie schon „Tage der Toten“, gehört „Das Kartell“ nicht zu Don Winslows besten Büchern. Vor allem der Humor und die pointierte Verknappung fehlen. Stattdessen werden die Ereignisse oft in einer nüchternen Nachrichtenprosa beschrieben, die über die Strecke von achthundertdreißig Seiten ermüdet. Denn die Gewalt der Drogenkartelle gegeneinander und gegen die Bevölkerung geriet in den vergangenen zehn Jahren in Mexiko vollkommen außer Kontrolle. Aber nach dem dritten Massaker tendiert der Erkenntnisgewinn der Beschreibung des vierten Massakers an einer anderen Verbrecherbande, an Polizisten oder Zivilisten gegen Null. Es ist einfach nur mehr vom Gleichen.
Und wegen der vielen Charaktere und Handlungsstränge (die auch manchmal schnöde fallen gelassen werden; so begibt sich auf Seite 668 ein Drogengangster mit Kellers Hilfe in US-Schutzhaft. Erst viele Seiten später, auf Seite 715, erfahren wir in wenigen Sätzen, was mit ihm geschah, nachdem er sich bei Keller meldete und in US-amerikanische Schutzhaft begeben hat) und der langen Zeit, die die Geschichte umfasst, bleibt „Das Kartell“ dann als ein an allen Ecken und Enden ausfaserndes Werk, das wirklich alles über den Drogenkrieg sagen will (und dabei doch einiges weglässt), doch an der Oberfläche. Dass Don Winslow es besser kann, zeigt er in seinen kürzeren Romanen, die auch nicht durch den Duktus der Faktentreue gebremst werden. In ihnen steigt er wesentlich tiefer in den von den USA in Südamerika geführten, in jeder Beziehung absurden und zunehmend irrationalen Drogenkrieg ein. Also besser „Bobby Z“, „Savages – Zeit des Zorns“ oder „Kings of Cool“, die auch stilistisch überzeugender sind, lesen.

Don Winslow: Das Kartell
(übersetzt von Chris Hirte)
Knaur, 2015
832 Seiten
16,99 Euro
–
Originalausgabe
The Cartel
Alfred A. Knopf, 2015
–
Hinweise
Hollywood & Fine: Interview mit Don Winslow (11. Juli 2012)
Homepage von Don Winslow (etwas veraltet, weil eigentlich eine Verlagsseite)
Deutsche Homepage von Don Winslow (von Suhrkamp)
Don Winslow twittert ziemlich oft
Meine Besprechung von Don Winslows “London Undercover” (A cool Breeze on the Underground, 1991)
Meine Besprechung von Don Winslows “China Girl” (The Trail to Buddha’s Mirror, 1992)
Meine Besprechung von Don Winslows „Bobby Z“ (The Death and Life of Bobby Z, 1997)
Meine Besprechung von Don Winslows „Tage der Toten“ (The Power of the Dog, 2005)
Meine Besprechung von Don Winslows „Pacific Private“ (The Dawn Patrol, 2008)
Meine Besprechung von Don Winslows „Satori“ (Satori, 2011)
Mein Interview mit Don Winslow zu “Satori” (Satori, 2011)
Meine Besprechung von Don Winslows “Savages – Zeit des Zorns” (Savages, 2010)
Meine Besprechung von Don Winslows “Kings of Cool” (The Kings of Cool, 2012)
Meine Besprechung von Don Winslows „Vergeltung“ (Vengeance, noch nicht erschienen)
Meine Besprechung von Don Winslows “Missing. New York” (Missing. New York, noch nicht erschienen)
Meine Besprechung von Oliver Stones Don-Winslow-Verfilmung „Savages“ (Savages, USA 2012)
Don Winslow in der Kriminalakte
DVD-Kritik: Über die Jussi-Adler-Olsen-Verfilmung „Schändung – Die Fasanentöter“
August 25, 2015
Es hilft nichts. Auch die Veränderungen im Drehbuch von Nikolaj Arcel und Rasmus Heisterberg machen aus Jussi Adler-Olsen spannungsloser Geschichte „Schändung“ keinen Thriller. Die Täter sind beide Male von Anfang an bekannt, was ja nicht unbedingt ein Nachteil ist. So basiert die grandiose Krimiserie „Columbo“ auf dieser Idee. Aber in „Columbo“ sind die Verbrecher intelligent, die Konfrontationen zwischen dem Ermittler und dem Mörder sind vergnügliche Schlagabtäusche, Katz-und-Maus-Spiele zwischen intelligenten Kontrahenten, und in jeder Szene erfahren wir etwas neues.
In „Schändung“, und da unterscheiden sich der Roman seine Verfilmung nicht, ist es anders. Es gibt einfach keine nennenswerten Konfrontationen und, nachdem wir die Ausgangssituation kennen, auch keine neuen Erkenntnisse. Die gesamte Geschichte quält sich über 450 Seiten (im Roman) oder gut 120 Minuten (im Film) auf ihr Ende zu. Schon am Anfang erfahren wir, dass eine Gruppe stinkreicher Internatsschüler vor zwanzig Jahren zwei Jugendliche ermordeten. Bjarne Thøgersen gestand den Doppelmord und sitzt dafür im Gefängnis. Der Fall ist offiziell abgeschlossen.
Jetzt beginnt Carl Mørck vom Sonderdezernat Q, der Abteilung für alte, nicht abgeschlossene Fälle, den Fall neu aufzurollen. Im Roman weil die Akte wie von Geisterhand auf seinem schon gut gefülltem Schreibtisch auftaucht und es, anstatt sich irgendeinen ungeklärten alten Mordfall vorzunehmen, natürlich grundvernünftig ist, einfach einen geklärten alten Mordfall noch einmal zu untersuchen. Vielleicht haben die Kollegen ja Mist gebaut und vielleicht ist der geständige Täter, der sein Geständnis nicht widerrufen möchte, doch nicht der Täter. Wer jetzt glaubt, dass Mørcks Verhalten idiotisch ist, wird an Adler-Olsens Roman keine Freude haben. Aber eigentlich sollte er nach dem ersten Sonderdezernat-Q-Roman „Erbarmen“ schon vorgewarnt sein.
Im Film ist Mørcks Verhalten immerhin besser motiviert: Eines Nachts begegnet er im Regen (wegen der atmosphärischen Bilder) einem offensichtlich verwirrten Mann, der ihm die alte Akte gibt. Am nächsten Tag ist er tot. Suizid. Er war ein Ex-Polizist und der Vater der beiden toten Teenager. Getrieben von dem Gefühl, dem Mann nicht geholfen zu haben, sieht Mørck sich den Fall wieder an.
Zur gleichen Zeit läuft die Obdachlose Kimmie durch Kopenhagen. Sie ist eine der damaligen Täter und jetzt will sie sich an den anderen Tätern rächen. Ohne jetzt allzutief in die Psychologie einzusteigen: weil Jussi Adler-Olsen es so will und es in der Theorie doch gut klingt: während die Polizei die Täter sucht, will einer der Täter die anderen umbringen und jetzt haben wir einen Wettlauf mit der Zeit. Denn wer erreicht zuerst sein Ziel? Die Ausführung steht dann auf einem anderen Blatt und das Ende bringt diese beiden Plots mit mehr Zufall als Verstand oder innerer Logik zusammen.
Unglaubwürdige Charaktere, eine unplausible Geschichte, fehlende Konfrontationen, fehlende Konflikte – das ist das Rezept für einen veritablen Langweiler, der in diesem Fall immerhin Mørcks Privatleben links liegen lässt. Dieses Fazit gilt für den Roman und die Verfilmung.
Jetzt, nach der zweiten Sichtung, fällt mir auf, dass ich die gewohnt wertige skandinavische Optik nicht lobte. Und in zwei Punkten war ich etwas ungenau. Bjarne Thøgersen hat seine Strafe nämlich schon verbüßt und er wurde für sein Geständnis, was den beiden Ermittlern sofort auffällt, fürstlich entlohnt. Und Kimmie ist im Film nur noch eine gequälte Seele; – was einige Wendungen psychologisch umso unverständlicher macht. Im Roman verfolgt sie konsequenter ihren Racheplan; – was psychologisch auch nicht sonderlich nachvollziehbar ist. Immerhin ist die Verfilmung gelungener als der Roman.
Ob ich jemals ein Adler-Olsen-Fan werde? Immerhin gibt es mit „Erlösung“ einen dritten Versuch, der ab Mitte Juni 2016 in unseren Kinos laufen soll und der, bis auf den Regisseur (Hans Petter Moland übernahm), mit dem bewährtem Team gedreht wird. Vielleicht ist dieser Mørck-Film, in dem es um verschwundene Kinder geht, kein Murks, für den vor allem Romanautor Jussi Adler-Olsen verantwortlich ist.
Das Bonusmaterial ist ziemlich umfangreich und auch informativ geraten, was vor allem daran liegt, dass Regisseur Mikkel Nørgaard im 26-minütigem „Making of“ ausführlich zu Wort kommt. Mit den beiden Hauptdarstellern Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares gibt es außerdem kürzere Interviews (8 und 6:30 Minuten), die im Rahmen der Werbung für den deutschen Kinostart gemacht wurden.
Schändung – Die Fasanentöter (Fasandræberne, Dänemark/Deutschland/Schweden 2014)
Regie: Mikkel Nørgaard
Drehbuch: Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg
LV: Jussi Adler-Olsen: Fasandræberne, 2008 (Schändung)
mit Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbaek, David Dencik, Danica Curcic, Johanne Louise Schmidt
–
DVD
NFP marketing & distribution (Vertrieb: Warner Bros.)
Bild: 2,35:1 (16:9)
Ton: Deutsch, Dänisch
Untertitel: Deutsch
Bonusmaterial: Making of, Interviews mit Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares, Trailer, Teaser, Hörfilmfassung
Länge: 115 Minuten
FSK: ab 16 Jahre
–
Die Vorlage
Jussi Adler-Olsen: Schändung
(übersetzt von Hannes Thiess)
dtv, 2015 (Filmausgabe)
464 Seiten
9, 95 Euro
–
Deutsche Erstausgabe
dtv premium, 2010
–
Originalausgabe
Fasandræberne
Politikens Forlagshus A/S, Kopenhagen, 2008
–
Hinweise
Homepage zum Film
Film-Zeit über „Schändung“
Moviepilot über „Schändung“
Rotten Tomatoes über „Schändung“
Dänische Homepage von Jussi Adler-Olsen
Deutsche Homepage von Jussi Adler-Olsen
Krimi-Couch über Jussi Adler-Olsen
Wikipedia über Jussi Adler-Olsen
Meine Besprechung von Jussi Adler-Olsens „Erbarmen“ (Kvinden i buret, 2008)
„From Hell“ in einer handlicheren Ausgabe
August 19, 2015Über „From Hell“ muss ich wohl wenig sagen. Immerhin gehört der auch verfilmte Comic (Alan Moore war auch von dieser Verfilmung nicht begeistert) zu den unumstrittenen Graphic-Novel-Klassikern und bei sechshundert Seiten kann man wirklich von ‚Novel‘ sprechen. Autor Alan Moore und Zeichner Eddie Campbell erzählen ihre faktengespickte Version der Geschichte von Jack the Ripper (meine ausführliche Besprechung gibt es hier).
Nachdem die vorherige Hardcover-Ausgabe wie ein Backstein in den Händen lag, erschien jetzt bei Cross Cult eine günstigere und auch leichtere Papberback-Edition.
–
Alan Moore (Autor)/Eddie Campbell (Zeichnungen): From Hell
(übersetzt von Gerlinde Althoff)
Cross Cult, 2015
592 Seiten
35 Euro
–
Deutsche Erstausgabe dieser Ausgabe
Cross Cult, 2008
–
Reprint als Hardcover
2011
–
Originalausgabe/überarbeitete Gesamtausgabe
From Hell
Eddie Campbell Comics, 1999
–
Hinweise
Comic Book Database über Alan Moore
Alan-Moore-Fanseite (etwas veraltet)
Wikipedia über “From Hell” (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Alan Moore/Dave Gibbons’ „Watchmen” (Watchmen, 1986/1987)
Meine Besprechung von Alan Moore/Eddie Campbells “From Hell” (From Hell, 1999)
George A. Romeros „Empire of the Dead“, der zweite Akt
August 12, 2015Zombies sind schon nervig. Vor allem wegen ihrer Essgewohnheiten und ihres oft rudelhaften Auftretens. Aber fünf Jahre nachdem die ersten Untoten über die Erde stampften, ist Manhattan eine sichere Festung gegen sie geworden. Regiert wird die Stadt von Bürgermeister Chandrake, der ein Vampir ist. Das weiß allerding,s außer den anderen Vampiren seines Clans, niemand. Und das ist auch die größte Überraschung in der von George A. Romero erfundenen Comicserie „Empire of the Dead“, die natürlich bruchlos an seine Spielfilme und die in ihnen etablierte Zombie-Mythologie anknüpft.
Neben dem Chandrake-Clan ist die Ärztin Penny Jones eine der Hauptpersonen des Comics. Sie versucht herauszufinden, ob es ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen und Untoten geben kann. Als sie Xavier, einen zum Zombie mutierten Polizisten, trifft und dieser anscheinend immer noch über Empathie und Intelligenz verfügt, hat sie ein vielversprechendes Forschungsobjekt, das auch Einfluss über andere Zombies gewinnt.
Und dann, aber das wissen die New Yorker im zweiten Akt von „Empire of the Dead“ nicht, lauert vor den Toren der Stadt eine aus den Südstaaten kommende Rebelleneinheit darauf, die Stadt zu überfallen. Sie wartet nur noch auf das Einverständnis ihrer in der Stadt undercover lebenden Anführerin.
Nachdem der erste Akt von „Empire of the Dead“ in die Welt einführte, plätschert der zweite Akt reichlich spannungslos zwischen den verschiedenen Handlungsorten und angedeuteten Handlungssträngen hin und her. Im Mittelpunkt steht dabei, soweit davon gesprochen werden kann, ein mäßig interessanter Bürgermeisterwahlkampf, während im Hintergrund, als neue Bedrohung, eine Gruppe Südstaatler darauf wartet, endlich New York zu überfallen.
Insofern ist der zweite Akt nur die Vorbereitung für den dritten Akt, der auch die auf fünfzehn Hefte angelegte Miniserie beendet. In den USA erscheint das finale Heft von „Empire of the Dead“ am 26. August 2015. Der Sammelband „Act Three“ ist für Oktober angekündigt. Die deutsche Ausgabe dürfte kurz danach erschienen.
–
George A. Romero/Dalibor Talajic: Empire of the Dead – Zweiter Akt
(übersetzt von Joachim Körber)
Panini, 2015
116 Seiten
14,99 Euro
–
Originalausgabe
Empire of the Dead: Act Two # 1 – 5
Marvel, November 2014 – März 2015
–
Hinweise
Marvel über „Empire of the Dead“
Wikipedia über „Empire of the Dead“ und George A. Romero (deutsch, englisch)
Senses of Cinema über George A. Romero (von Brian Wilson, November 2006)
Arte über George A. Romero (mit bewegten Bildern zum Start von “Diary of the Dead”)
tip: Jörg Buttgereit unterhält sich mit George A. Romero (5. Mai 2010)
Shock till you drop interviewt George A. Romero (12. Mai 2010)
Homepage of the Dead (eine lebendige Fanseite)
Dead Source (noch eine Fanseite; schon etwas untot)
Internet Archive: “The Night of the Living Dead” (Yep, der komplette Film mit dem alles begann)
Meine Besprechung von Georg Seeßlens „George A. Romero und seine Filme“(2010)
Andy Diggle und Jock erzählen „Green Arrow: Das erste Jahr“
August 10, 2015Der neue Comic von Autor Andy Diggle und Zeichner Jock, denen wir die grandiosen „Losers“ verdanken, ist eigentlich ein ziemlich alter. Denn im Original erschien „“Green Arrow: Year One“ bereits 2007 und er war die Inspiration für die seit 2012 laufende TV-Serie „Arrow“; was sich deutlich an einer Story-Linie der ersten Staffel und der fast schon inflationären Verwendung des Nachnamens Diggle zeigt. Oh, und China White ist dabei.
Doch die Serie, die im deutschen TV bei Vox läuft, soll uns hier nicht weiter interessieren. In der abgeschlossenen Comicserie „Green Arrow: Das erste Jahr“ erzählen Andy Diggle und Jock, wie aus Oliver Queen, einem vergnügungssüchtigem, egozentrischem, ziellos durch das Leben driftendem, den Adrenalinkick suchendem Milliardenerbe, der für die Gerechtigkeit kämpfende ‚Green Arrow‘ wird.
Auf einer Auktion ersteht Oliver den Langbogen von Howard Hill, einem Kunstschützen, der Errol Flynn in dem legendären Abenteuerfilm „Robin Hood, König der Vagabunden“ (The Adventures of Robin Hood, USA 1938) in den Szenen mit Pfeil und Bogen doubelte.
Weil er bei dieser Auktion betrunken aus der Rolle des gesitteten Playboys fiel, beschließt er, seinen Bodyguard und Vertrauten Hackett bei einer Bootstour zu den Fidschis zu begleiten. Dummerweise wollte Hackett die Bootstour benutzen, um mit 14 Millionen Dollar, die er von Oliver geklaut hat, zu verschwinden. Als Oliver das erfährt, kämpfen sie auf der Luxusyacht miteinander und Hackett wirft den schwer verletzten Playboy über Bord.
Aber Oliver stirbt nicht. Er wird an den Strand einer Insel gespült. Er richtet sich dort ein, erledigt mit einem Bogen Tiere und entdeckt eine riesige Mohnplantage. Auf der Plantage schuften die Einheimischen. Betrieben wird sie von Chien Na-Wei, auch bekannt als China White, einer ebenso schönen wie skrupellosen Drogenhändlerin. Sie wird von Hackett begleitet.
Der bislang selbstsüchtige Oliver will sich jetzt nicht nur an Hackett für den Verrat rächen, sondern auch den Einheimischen helfen. Er wird zu Green Arrow.
„Green Arrow: Das erste Jahr“ ist ein flotter Actionthriller, der – und da verrate ich wohl kein großes Geheimnis – auf der Insel in einem blutigen Kampf zwischen Oliver und der Drogenbande mündet. Aber wer hätte ernsthaft von den Erfindern der „Losers“ etwas anderes erwartet?
–
Andy Diggle/Jock: Green Arrow: Das erste Jahr
(übersetzt von Marc Schmitz)
Panini, 2015
148 Seiten
14,99 Euro
–
Originalausgabe
Green Arrow: Year One # 1 – 6
DC Comics, 2007
(2008 als Sammelband)
–
Hinweise
Wikipedia über Andy Diggle, Jock und Green Arrow (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Andy Diggle/Jocks „The Losers: Goliath – Band 1“
Meine Besprechung von Andy Diggle/Jock/Shawn Martinbroughs „The Losers: Die Insel – Band 2“
Meine Besprechung von Andy Diggle/Jock/Nick Dragotta/Alé Garza: The Losers: Der Pass, Band 3 (The Losers 13 – 19, 2005)
Meine Besprechung von Andy Diggle/Jock/Ben Olivers (Zeichner) „The Losers: London Calling (Band 4) (The Losers # 20 – 25, 2005)
Vorbereitende Lektüre: Don Winslow: Tage der Toten
August 8, 2015
Als Don Winslow in den USA schon seit einigen Jahren abgefeiert wurde, war er vom deutschen Buchmarkt komplett verschwunden. Erst Suhrkamp änderte das vor sechs Jahren mit „Pacific Private“, „Pacific Paradise“ und „Frankie Machine“ und dann erschien im September 2010 Don Winslows Opus Magnum; was man halt so sagt, wenn das Buch deutlich dicker als die anderen Werke des Abgefeierten ist und die deutsche Kritik war entsprechend euphorisch. Aus dem Hinterkopf war der Tenor der Besprechungen:
Meisterwerk
Meisterwerk
Meisterwerk
Meisterwerk
Meisterwerk
Meisterwerk
und manchmal auch
Bester Roman des Jahres
Bester Roman des Jahrzehnts
Nur „der Roman, der das Genre neu erfindet“ wurde, glaube ich (wenn ich mich irre: sagt es in den Kommentaren), nie geschrieben. Das wird dafür seit einigen Jahren bei jeder zweiten neuen TV-Serie gesagt.
Eine negative Kritik gab es nur im „Spiegel“ (wenn es irgendwo einen richtigen Verriß gab, verratet es ebenfalls in den Kommentaren).
„Tage der Toten“ stand auf dem ersten Platz der „Buchkultur“-Liste der Krimis, die man in diesem Sommer (also damals diesem) lesen sollte. Naja, mit siebenhundert Seiten empfiehlt er sich schon wegen des Umfangs als Strandlektüre.
Er stand auf dem ersten Platz der Jahresbestenliste der KrimiWelt-Juroren (inzwischen KrimiZeit).
Die Ausbeute an Preisen war dagegen überschaubar: es gab den deutschen Krimipreis und, in Japan, den Maltese Falcon Award
und wie liest sich „Tage der Toten“ zehn Jahre nach seiner US-Publikation und fünf Jahre nach seiner deutschen Veröffentlichung?
Gut.
.
.
.
.
Ausführlicher?
Gut, aber nicht so überragend, wie man nach dem Presseecho meinen könnte. Die wenigen Preise und Nominierungen (so war „Tage der Toten“ nicht für den Edgar nominiert) verraten schon etwas und natürlich hat ein megadickes Buch auch immer etwas von einer Fleißarbeit. So als möchte der Autor, wenn er seine normale Seitenlänge massiv überschreitet, sagen: Seht her, ich kann den großen amerikanischen Roman, das Buch, das alles über unsere Gesellschaft verrät, schreiben. Und diese Anstrengung ist dann auch auf jeder Seite spürbar.
Nach den fünf Neal-Carey-Romanen, „Manhattan“ (Isle of Joy) und den beiden California-Noirs „Bobby Z“ (The Death and Life of Bobby Z) und dem mit dem Shamus ausgezeichnete „Die Sprache des Feuers“ (California Fire and Life) legte Don Winslow eine sechsjährige Veröffentlichungspause ein, in der er „Tage der Toten“ (The Power of the Dog) schrieb. Er erzählt von dem Kampf zwischen DEA-Agent Art Keller und dem mexikanischem Drogenbaron Adán Barrera zwischen 1975 und, ohne den 2004 spielenden Epilog, 1999.
Dazu kommen noch einige wichtige Nebencharaktere: die Prostituierte Nora Hayden, die zu Barreras Geliebten wird, der irische, im Hell’s Kitchen in New York aufgewachsene Gangster Callan, der auch in Südamerika mordet, und, weil in Südamerika ohne die Religion überhaupt nichts geht, der katholische Geistliche Vater Parada, der zum Erzbischof von Guadalajara wird.
Außerdem zeichnet Don Winslow die Verflechtungen zwischen nord- und südamerikanischer Politik nach. Denn, – das geriet in den letzten Jahren im Rahmen des Antiterrorkampfes etwas aus dem öffentlichem Fokus -, die USA betrachteten Südamerika seit Ewigkeiten als ihren Hinterhof. Sie mischten sich ungefragt in die dortige Politik ein. Sie stürzten Staatsoberhäupter und unternahmen, im Rahmen der Dominotheorie alles, damit es im Süden keine linken Regierungen (die natürlich alles kommunistisch waren) gibt. Und sie führten eine (erfolglosen) Antidrogenkrieg, der das Wort Krieg wirklich verdient hatte.
Es ist also ein großes Epos, das Don Winslow hier schreiben will. Es ist auch ein nur leicht fiktionalisiertes Geschichtsbuch, das einen heute noch mehr als 2005 verdrängten und auch vergessenen Krieg in Erinnerung ruft. Die Menge an Fakten, die Winslow, der bekennende Geschichts-Geek, ausbreitet, ist schon beeindruckend, hat aber auch etwas von einem Geschichtsbuch, in dem ohne große Unterschiede das Wichtige und das Unwichtige aufgenommen wurde. Unter den Details und breit geschilderten Szenen, wie geplanten, aus verschiedenen Perspektiven geschilderten Verhaftungen oder einer tödlichen Rache, gehen dann schon einmal die großen Linien verloren.
Vom Tonfall liest sich „Tage der Toten“ wie eine lange Reportage, die damit auch das von Don Winslow oft benutzte Präsens rechtfertigt. Es ist für Zeitungsberichte die normale Erzählzeit. Der gewitzte und pointierte Tonfall seiner vorherigen und späteren Romane findet sich hier nicht. „Tage der Toten“ ist, verglichen mit den gerade gelesenen Neal-Carey-Romanen, erschreckend dröge.
Storytechnisch erinnert „Tage der Toten“ dann an eine dieser langen TV-Serie, in der bestimmte Ereignisse breit gezeigt werden, während in einer gerafften Zusammenfassung andere Ereignisse schnell zusammengefasst werden und bestimmte Charaktere über viele Seiten vollkommen aus der Handlung verschwinden. Das gilt auch erstaunlich oft für den Protagonisten Art Keller, der damit erstaunlich blass bleibt. Sowieso bleiben alle Charaktere eher blass.
Dieses Jahr erschien, fast zeitgleich, „Das Kartell“ (The Cartel), die Fortsetzung von „Tage der Toten“ und ich bespreche es die Tage.
Von der Verfilmungsfront gibt es auch Neuigkeiten: „Frankie Machine“ (The Winter of Frankie Machine, 2006) soll jetzt von William Friedkin verfilmt werden. Er möchte es, mit einem kleinen Budget, als harten Thriller verfilmen. Don Winslow soll am Drehbuch mitarbeiten.
Don Winslow: Tage der Toten
(übersetzt von Chris Hirte)
Suhrkamp, 2010
704 Seiten
9,99 Euro (Taschenbuchausgabe)
–
Originalausgabe
The Power of the Dog
Alfred A. Knopf, 2005
–
Hinweise
Hollywood & Fine: Interview mit Don Winslow (11. Juli 2012)
Homepage von Don Winslow (etwas veraltet, weil eigentlich eine Verlagsseite)
Deutsche Homepage von Don Winslow (von Suhrkamp)
Don Winslow twittert ziemlich oft
Meine Besprechung von Don Winslows „London Undercover“ (A cool Breeze on the Underground, 1991)
Meine Besprechung von Don Winslows „China Girl“ (The Trail to Buddha’s Mirror, 1992)
Meine Besprechung von Don Winslows „Bobby Z“ (The Death and Life of Bobby Z, 1997)
Meine Besprechung von Don Winslows „Pacific Private“ (The Dawn Patrol, 2008)
Meine Besprechung von Don Winslows „Satori“ (Satori, 2011)
Mein Interview mit Don Winslow zu “Satori” (Satori, 2011)
Meine Besprechung von Don Winslows “Savages – Zeit des Zorns” (Savages, 2010)
Meine Besprechung von Don Winslows “Kings of Cool” (The Kings of Cool, 2012)
Meine Besprechung von Don Winslows „Vergeltung“ (Vengeance, noch nicht erschienen)
Meine Besprechung von Don Winslows “Missing. New York” (Missing. New York, noch nicht erschienen)
Meine Besprechung von Oliver Stones Don-Winslow-Verfilmung „Savages“ (Savages, USA 2012)
DVD-Kritik: „Polizeiruf 110“ – die zweite Kommissar-Tauber-Lieferung
Juli 29, 2015
Dass der „Polizeiruf 110“ der bessere „Tatort“ ist, wird niemand behaupten. Eher schon das Gegenteil und er war nach der Einheit ein Minigeschenk an die DDR. Denn dort gab es, als Alternativprogramm zum westdeutschen „Tatort“, den „Polizeiruf 110“, der Verbrechen sozialistisch aufklärte. Diese Piefigkeit bewahrte er sich. Einerseits. Andererseits wurde auch teilweise wild experimentiert und die aus München kommenden „Polizeirufe“ waren und sind immer einen Blick wert.
Einen Blick in die Vergangenheit gestattet die „Polizeiruf 110“-Box „Die Folgen des BR 2000 – 2003“, in denen Kommissar Jürgen Tauber ermittelte. Edgar Selge spielte den einarmigen Ermittler von 1998 bis 2009 in zwanzig Folgen. In der Box sind sechs Fälle enthalten und, auch wenn einige legendäre Folgen erst später liefen (wie „Der scharlachrote Engel“ und „Er sollte tot“, beide von Dominik Graf, beide mit mehreren Preisen ausgezeichnet), sind die hier gesammelten und ebenfalls ausgezeichneten Fälle ebenfalls, immer noch, einen Blick wert. „Gelobtes Land“ war für den Grimme-Preis nominiert; Nadeshda Brennicke erhielt für „Silikon Walli“ den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin und Edgar Selge für „Tiefe Wunden“ und „Pech und Schwefel“ (ebenfalls von 2003, aber nicht in dieser Box enthalten) den Deutschen Fernsehpreis.
In der 3-DVD-Box sind enthalten:
Verzeih‘ mir (Deutschland 2000)
Regie: Hartmut Griesmayr
Drehbuch: Horst Vocks
–
Gelobtes Land (Deutschland 2001)
Regie: Peter Patzak
Drehbuch: Christian Limmer
–
Fluch der guten Tat (Deutschland 2001)
Regie: Hans-Günther Bücking
Drehbuch: Peter Probst
–
Um Kopf und Kragen (Deutschland 2002)
Regie: Peter Patzak
Drehbuch: Carolin Otto
–
Silikon Walli (Deutschland 2002)
Regie: Manfred Stelzer
Drehbuch: Wolfgang Limmer
–
Tiefe Wunden (Deutschland 2003)
Regie: Buddy Giovinazzo
Drehbuch: Christian Limmer
–
Die meisten Namen werden den Krimifans etwas sagen. Auch weil einige der Drehbuchautoren auch Romane veröffentlichten. Christian Jeltsch schrieb einige Jugendbücher; Wolfgang Limmer eher anekdotisches. Christian Limmer und Peter Probst schreiben inzwischen erfolgreich Kriminalromane. Horst Vocks schrieb auch einige Kriminalromane, aber bekannter ist er vor allem für seine Bücher für „Der Fahnder“ und mehrere „Tatorte“, die fast immer etwas mit Horst Schimanski zu tun hatten. Unter anderem „Duisburg Ruhrort“, „Der unsichtbare Gegner“, „Freunde“ und „Zahn um Zahn“, der auch erfolgreich im Kino lief (die Kritiker waren weniger begeistert). Später, für die Serie „Schimanski“ schrieb er auch mehrere Drehbücher. Angesichts dieser Vita fallen in „Verzeih‘ mir“, inszeniert von Routinier Hartmut Griesmayr, einige Dialoge arg hölzern aus. Aber der einarmige Kommissar Jürgen Tauber (Edgar Selge) darf einige herrliche Gemeinheiten absondern und seine Beziehung zur Kriminalpsychologin Dr. Sylvia Jansen (Gaby Dohm) ist angenehm erwachsen. Der Fall selbst – ein Automechaniker wird ermordet in einem verbrannten Auto gefunden; eine Mutter und ihre Tochter, die beide Bettgenossinen von ihm waren, verdächtigen sich gegenseitig des Mordes und das Organisierte Verbrechen, in Form von Autoschiebern, ist ebenfalls involviert – ist in Punkto Tätersuche nicht sonderlich kompliziert. Dafür gibt es eine interessante Familiengeschichte, die bis zum Kriegsende zurückreicht.
„Gelobtes Land“, der erste Auftritt von Taubers neuer Kollegin ‚Jo‘ Obermeier (Michaela May), Mutter, verheiratet mit einem türkischen Besitzer einer kleinen Autowerkstatt, ist ein gelungener Krimi über Asylbewerber und wie sie nach Deutschland kommen.
Peter Patzak, der seit „Kottan ermittelt“ im Pantheon des deutschsprachigen Kriminalfilms ist, inszenierte auch „Um Kopf und Kragen“. In dem Fall ermittelt Jo Obermaier undercover in einer Polizeistation. Eine Kollegin, die gemobbt wurde, soll sich umgebracht haben. Aber die Schwangere wurde ermordet. In einigen Szenen scheint der Geist von Kottan durch, aber insgesamt ist „Um Kopf und Kragen“ ein durch die hoffnungslos überbelichtete Inszenierung und die gewollt übertriebenen Darstellungen ein unansehbares Werk geworden.
In „Fluch der guten Tat“ wird ein Roma-Junge, der von einer Initiative für sozial schwache Kinder betreut wurde, ermordet. Tauber und Obermaier sehen sich bei der Initiative, die nicht nur von altruistischen Motiven getriebne ist, um.
„Silikon Walli“ und „Tiefe Wunden“ gehören zu den unbestrittenen Höhepunkten der Serie. In „Silikon Walli“ stirbt ein Busenwunder (nachdem ihre Oberweite mehrmals künstlich vergrößert wurde) eines unnatürlichen Todes – und Kommissar Tauber ist sehr fasziniert von den Gepflogenheiten des Sexgewerbes. Grandios!
Ebenfalls grandios ist „Tiefe Wunden“, inszeniert von Buddy Giovinazzo, der auch einige grandiose Noirs schrieb. Im Wald wird eine erschossene Goldschmiedin gefunden. In ihrer Hand hält sie einen Zigarillo, der Tauber an ein Gaunertrio, das er von früher kennt, erinnert. Entsprechend schnell führen die Ermittlungen in Taubers Vergangenheit und wir erfahren, wie er seinen Arm verlor.
Allein schon wegen der sechs „Polizeirufe“, die ein insgesamt erstaunlich hohes Niveau haben (eigentlich enttäuscht nur „Um Kopf und Kragen“) ist „Die Folgen des BR 2000 – 2003 – Box 2“ eine empfehlenswerte DVD-Box. Trotzdem ist es ärgerlich, dass es keine Untertitel und kein Bonusmaterial (Gab es wirklich kein Interview und keine Reportage in den TV-Archiven? Hätte man nicht ein „Making of“ machen können?) gibt.
Polizeiruf 110: Die Folgen des BR 2000 – 2003 (Box 2)
mit Edgar Selge (Kommissar Jürgen Tauber), Michaela May (Kommissarin Jo Obermeier), Gaby Dohm (Polizeipsychologin Dr. Sylvia Jansen), Tayfun Bademsoy (Tarik Yilmaz)
Gaststars: Karin Boyd, Dennenesch Zoudé, Matthias Koeberlin, Henning Baum, Heikko Deutschmann, Axel Hacke, Jacques Breuer, Nadeshda Brennicke, Bernd Tauber, Wanja Mues, Catherine Flemming, Thure Riefenstein
–
DVD
Eurovideo
Bild: 1.78:1 (16:9 anamorph – mit zum Teil eigeschränkter Bild- und Tonqualität)
Ton: Deutsch (DD 2.0)
Untertitel: –
Bonusmaterial: –
Länge: 503 Minuten (3 DVDs)
FSK: ab 12 Jahre
–
Hinweise
Das Erste über den „Polizeiruf 110“
Wikipedia über den „Polizeiruf 110“ und die Kommissare Tauber und Obermaier
Meine Besprechung von Peter Probsts „Blinde Flecken“ (2010)
Meine Besprechng von Peter Probsts „Im Namen des Kreuzes“ (2012)
Wikipedia über Buddy Giovinazzo (deutsch, englisch)
Krimi-Couch über Buddy Giovinazzo
One Road.Endless Possibilities: Interview mit Buddy Giovinazzo (21. Februar 2011, deutsch)
Meine Besprechung von Buddy Giovinazzos “Cracktown” (Life is hot in Cracktown, 1993)
Meine Besprechung von Buddy Giovinazzos “Piss in den Wind” (Caution to the winds, 2009)
Buddy Giovinazzo in der Kriminalakte
–
Bonushinweis
Horst Vocks hat nach langem Schweigen einen neuen Roman veröffentlicht. Zusammen mit Elfi Hartenstein schrieb er den Krimi „Ausstieg“ über Kriminalhauptkommissar Lou Feldmann, der keinen Bock mehr hat und reihenweise Verbrecher laufen lässt, bis er sich entscheiden muss, ob er so weitermachen will.
Ist natürlich, weil die Geschichte in Berlin spielt und blinder Lokalpatriotismus alles schlägt, ein verdammt guter Krimi.
–
Elfie Hartenstein/Horst Vocks: Ausstieg
Pendragon, 2015
328 Seiten
12,99 Euro
Ken Bruen, Inspector Brant, „Kaliber“ und die Sache mit den Manieren
Juli 28, 2015
Über seinen Privatdetektiv Jack Taylor sagte Ken Bruen, die Fälle würden nicht wegen, sondern trotz ihm gelöst. Das gleiche hätte er über die Romane mit Inspector Brant, einer aus sieben, zwischen 1998 und 2007 erschienenen Romanen bestehende Serie von in London spielenden Polizeiromanen, sagen können. Denn Brant und seine Kollegen lösen die Fälle auch nicht aufgrund guter Polizeiarbeit. Die meiste Zeit sind sie mit Drogen, Alkohol, persönlichen Problemen und internen Feindseligkeiten beschäftigt, während die Ermittlungen sich meist als eine persönliche Vendetta gestalten, in der Recht und Gesetz manchmal benutzte Leitplanken sind, um ihre Aggressionen abzubauen. Das ist zwar formal immer noch von Ed McBain und seiner Serie um das 87. Polizeirevier beeinflusst, aber bei Ken Bruen liest sich das wie McBain auf Speed und mit einer Punkattitüde.
Jetzt, nachdem seine bekanntere Serie mit dem Galway-Privatdetektiv Jack Taylor seit einigen Jahren kontinuierlich übersetzt wird (wobei die Übersetzungen von Harry Rowohlt nicht unumstritten sind), und die Brant-Verfilmung „Blitz“ (mit Jason Statham) regelmäßig im Fernsehen läuft und auf DVD gut erhältlich ist, hat der Polar-Verlag einen ersten Brant-Roman veröffentlicht. Mit „Kaliber“ ist es der sechste Brant-Roman, in dem ein selbsternannter Manierenkiller die Londoner zu einem höflicheren Umgang miteinander erziehen will. Deshalb wendet er sich mit seiner Mission an die Öffentlichkeit. Er hat allerdings nicht mit Southeast-Sergeant Brant gerechnet. Der bittet eine Kollegin, der er vor kurzem geholfen hat (es war natürlich ein nicht ganz legaler Gefallen), darum, sich in der Öffentlichkeit möglichst unhöflich zu Benehmen. Sein ebenso einfacher wie bestechender Plan sieht vor, dass der Manierenkiller auf den Lockvogel hereinfällt und er ihn dann umbringen kann.
Daneben versucht Brant sich jetzt als Krimiautor. Sein Vorbild ist Ed McBain, von dem er alle Bücher hat. Seine Muse ist ein Kollege, den er unter Drogen setzt. Der Manierenkiller nennt sich – Ken Bruen geizt nie mit literarischen Verweisen – Ford. Nach Lou Ford, dem Ich-Erzähler in Jim Thompsons Noir-Klassiker „Der Mörder in mir“ (The Killer inside me, 1952 – Lesebefehl!). Aber er liest auch, wie er in seinem Tagebuch schreibt, die Herren Charles Willeford und Cornell Woolrich.
Langjährige Ken-Bruen-Fans werden „Kaliber“, wie seine anderen Romane an einem Abend lesen. Bruen verknappt seine Erzählung – in seinen Polizeiromanen jongliert er mit mehreren parallelen Plots – so sehr, dass fast nur noch die Pointe, die präzise Beobachtung, die sarkastische Bemerkung und die düstere, gegen alles und jeden austeilende Weltsicht übrigbleibt. Das verlangt einen aufmerksamen Leser, macht Spaß und steht in der Tradition von G. F. Newmans zwischen 1970 und 1974 im Original publizierter Bastard-Trilogie über den skrupellosen Scotland-Yard-Inspector Terry Sneed, der für seinen Aufstieg in einem korrupten System über Leichen geht und jede Dienstregel bricht. Diese umfassende Entmystifizierung des edlen britischen Polizisten erschienen erst in den Achtzigern auf Deusch bei Ullstein. James Ellroy ist ein aktuellerer und bekannterer Einfluss. Aber gegenüber Bruen erscheint Ellroy als verquast pompöser Erzähler. Während Ellroy hunderte Seiten braucht, um die Polizisten als Schweine zu zeigen, genügen Bruen – großzügig gelayoutet – knapp zweihundert Seiten um seine korrupten, rassistischen, homophoben und frauenfeindliche Beamte auf das Podest zu heben sie, die selbst all das sind, was sie ablehnen, herunterstoßen. Zum Vorbild taugt keiner und im wirklichen Leben möchte man ihnen auch nicht begegnen. Aber für einen Noir sind sie grandioser Stoff.
Uh, und noch eine erfreuliche Meldung: Max Fisher und Angela Petrakos erleben weitere Abenteuer. Ken Bruen und Jason Starr haben einen weiteren Noir mit ihnen geschrieben. „Pimp“ ist für März 2016 bei Hard Case Crime angekündigt. Wann und ob die deutsche Übersetzung erscheint ist unklar.
Ken Bruen: Kaliber
(übersetzt von Karen Witthuhn)
Polar, 2015
184 Seiten
12,90 Euro
–
Originalausgabe
Calibre
St. Martin’s Minotaur, 2006
–
Die Inspector-Brant-Ermittlungen
1. A White Arrest (1998)
2. Taming the Alien (1999)
3. The McDead (2000)
4. Blitz: or Brant Hits the Blues (2002)
5. Vixen (2003)
6. Calibre (2006)
7. Ammunition (2007)
–
Hinweise
Meine Besprechung von Ken Bruens Jack-Taylor-Privatdetektivromanen
Meine Besprechung von Ken Bruens „Jack Taylor fliegt raus“ (The Guards, 2001)
Meine Besprechung von Ken Bruens “Jack Taylor liegt falsch” (The Killing of the Tinkers, 2002)
Meine Besprechung von Ken Bruens „Sanctuary“ (2008)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Jason Starrs „Flop“ (Bust, 2006)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Jason Starrs „Crack“ (Slide, 2007)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Jason Starrs „Attica“ (The MAX, 2008)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Reed Farrel Colemans „Tower“ (Tower, 2009)
Neu im Kino/Buch- und Filmkritik: „Ant-Man“ – Marvels kleinster Held
Juli 23, 2015
Das ist wohl die Marvel-Version von einem kleinem Film. Und das liegt nicht an der Größe des Superhelden, der mit einem Anzug auf die Größer einer Ameise (daher auch der Titel „Ant-Man“) schrumpfen kann, sondern an der, nach dem Riesen-“Avengers: Age of Ultron“-Remidemmi kleinen und überschaubaren Geschichte.
Scott Lang (Paul Rudd) will nach einem Gefängnisaufenthalt nur noch ein ehrliches Leben führen und sich mit seiner Frau Maggie (Judy Greer) und seiner Tochter Cassie (Abby Ryder Fortson) aussöhnen. Maggie hat dummerweise einen neuen Liebhaber: den Polizisten Jim Paxton (Bobby Cannavale). Mit der Arbeit funktioniert es auch nicht wie geplant. Seine Einbrechertalente sind auf dem freien Arbeitsmarkt nicht gefragt und wenn seine Chefs erfahren, was er früher getan hat, ist er den Job los. Die Jobs, die ihm sein Freund Luis (Michael Peña, mal wieder grandios) anbietet, sind vor allem illegal. Trotzdem erklärt Lang sich bereit, bei einem Einbruch mitzumachen.
Kurz darauf wird er vom Hausherrn geschnappt. Es ist Dr. Hank Pym (Michael Douglas). Der Erfinder will Lang als neuen Ant-Man haben. Denn Pym hat sich mit seinem früheren Schützling Darren Cross (Corey Stoll) überworfen und Cross hat ihn aus seiner Firma Pym Technologies rausgedrängt. Jetzt steht Cross kurz vor dem Durchbruch bei seinen Forschungen für einen Ant-Man-Anzug: das Yellowjacket. Pym möchte das verhindern. Auch weil er weiß, welche seelischen Schäden das Verändern der Körpergröße hervorrufen kann. Also soll Lang das Yellowjacket aus der gut gesicherten Firmenzentrale von Pym Technologies klauen. Lang, Luis und ihre Freunde (nicht gerade Leuchten in ihrem Job) planen also, während einer Präsentation, den Anzug zu stehlen.
Marvel nennt „Ant-Man“ ihren Heist-Film. Aber letztendlich ist es ein Marvel-Film mit den typischen Vor- und Nachteilen, wie einem blassen Bösewicht (obwohl Corey Stoll sehr gehässig grinsen kann), einer teilweise arg plätschernden Story, einem gut aufgelegtem Cast und überzeugenden Action-Szenen. Es gibt einige Querverweise zu den anderen Marvel-Filmen, die – bis auf eine Kampfszene, die am Ende wieder aufgenommen wird – dieses Mal so nebenbei formuliert werden, dass sie auch als Scherz durchgehen können. Und es gibt in der schon erwähnten Kampfszene auch einen größeren Auftritt von einem aus den vorherigen Marvel-Filmen (ohne die „Guardians of the Galaxy“) bekannten Charakter. Damit werden, wie gewohnt, die anderen Geschichten etwas weiter erzählt und es wird gezeigt, dass auch dieser Film zu einem größeren Ganzen gehört. Und es gibt die bekannten Abspann-Sequenzen.
Dieses Mal gibt es sogar eine ordentliche Portion Humor. Allein schon die Idee eines auf Ameisengröße schrumpfenden Mannes und sein Training sind gut genug für einige Lacher in diesem immer bescheiden, um nicht zu sagen klein auftretenden Film.
Aber ein Heist-Film, auch wenn hier mehrmals eingebrochen wird, ist „Ant-Man“ nicht. Jedenfalls nicht mehr als ein James-Bond-Film. In einem klassischen Einbruchsfilm dreht sich alles um den Einbruch. Das Herzstück des Films ist die genaue Schilderung der Durchführung des Einbruchs. Die bekanntesten Heist-Filme sieht man sich wegen des Einbruchs an. In „Ant-Man“ sind die Einbrüche flott vorbei. Eigentlich wird nur der erste genauer geschildert, während die anderen Einbrüche sich vor allem auf die Action konzentrieren und wir kaum erfahren, was warum wie geklaut wird.
Die Action ist gewohnt spektakulär und gewinnt hier allein schon durch die Größe der Kämpfenden neue Dimensionen. So findet, weil die Kämpfenden auf Ameisengröße geschrumpft sind, ein Teil des Schlusskampfes in einem Kinderzimmer auf einer Modelleisenbahn statt. Die Zerstörung ist entsprechend überschaubar.
Seinen ersten Auftritt hatte Ant-Man Hank Pym 1962 in Band 27 der Comicreihe „Tales to Astonisch“ und er ist ein Mitglied der ursprünglichen Avengers. Pym hatte, so seine ursprüngliche Geschichte, eine Substanz entdeckt (das Pym-Partikel), die es ihm ermöglichte, seine Größe beliebig zu verändern und übermenschliche Kräfte zu haben, was in einem Gefecht vorteilhaft sein kann. Denn eine Ameise kann im Gefecht unverletzt hinter feindliche Linien gelangen und auch Gebäude infiltrieren. Das ist eine durchaus faszinierende Idee, über die man allerdings nicht zu lange nachdenken sollte, weil sie dann immer idiotischer wird. Und das würde einem den Spaß an diesem Film verderben.
Eine Comicversion
Pünktlich zum Filmstart erschien bei Panini Comics auch Robert Kirkmans („The Walking Dead“) „Ant-Man“-Version, die in den USA bereits 2007 erschien. Hier ist Ant-Man Eric O’Grady, ein kleiner S.H.I.E.L.D.-Soldat der unzuverlässigen Sorte. Zusammen mit seinem Freund Chris McCarthy soll er auf einem S.H.I.E.L.D.-Helicarrier (ein in der Luft schwebender Flugzeugträger) eine Tür bewachen. Weil sie allerdings nicht wissen, ob sie Leute am verlassen oder betreten des Raums hindern sollen, schlagen sie Dr. Hank Pym, der den Raum verlassen will, ohnmächtig, betreten den Raum und McCarthy probiert den Ant-Man-Anzug aus, was dazu führt, dass er auf Ameisengröße schrumpft und erst einmal tagelang durch die Station irrt. Bei einem Angriff von Hydra (den Bösewichtern) stirbt McCarthy und O’Grady schnappt sich den Anzug, den er fortan zum Beobachten von duschenden Frauen benutzt. Weil Shield befürchtet, dass der Anzug in die falschen Hände fällt (als sei er bei O’Grady in den richtigen), wird Mitch Carson, der auch ein guter Terminator wäre, beauftragt, O’Grady zu finden.
Robert Kirkmans Ant-Man ist eigentlich ein selbstbezogener Teenager, der außer Sex wenig im Kopf hat. Das ist im Superheldengenre ein witziger und respektloser Ansatz. Trotzdem sehen wir mehr seitenfüllende Kloppereien als nackte Frauen und O’Grady wird am Ende – und da verrate ich wohl kein großes Geheimnis – doch zu einem guten und ziemlich verantwortungsbewussten S.H.I.E.L.D.-Agenten. Kirkman erzählt in „Ant-Man“ eine ziemlich klassische Entwicklungsgeschichte, die, – für die Marvel-Fans -, vor und nach dem Civil War spielt.
Ant-Man (Ant-Man, USA 2015)
Regie: Peyton Reed
Drehbuch: Edgar Wright, Joe Cornish, Adam McKay, Paul Rudd (nach einer Geschichte von Edgar Wright und Joe Cornish)
LV: Charakter von Stan Lee, Larry Lieber, Jack Kirby
mit Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Peña, T. I., Wood Harris, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, David Dastmalchian, Anthony Mackie, Hayley Atwell, John Slattery, Martin Donovan, Stan Lee
Länge: 117 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–

Robert Kirkman (Autor)/Phil Hester/Cory Walker/Khary Randolph (Zeichner): Ant-Man Megaband
(übersetzt von Harald Gantzberg)
Panini, 2015
292 Seiten
28 Euro
–
Originalausgabe
The Irredeemable Ant-Man
Marvel, 2006/2007
–
enthält
Civil War: Choosing Sides (Dezember 2006)
The Irredeemable Ant-Man # 1 – 12 (Dezember 2006 – November 2007)
Amazing Fantasy (2004) 15 (Januar 2006)
–
Hinweise
Deutsche Facebook-Seite von Marvel
Englische Homepage zum Film
Film-Zeit über „Ant-Man“
Moviepilot über „Ant-Man“
Metacritic über „Ant-Man“
Rotten Tomatoes über „Ant-Man“
Wikipedia über „Ant-Man“ (deutsch, englisch)
Kriminalakte: Meine Gesamtbesprechung der ersten zehn „The Walking Dead“-Bände
Meine Besprechung der TV-Serie „The Walking Dead – Staffel 1“ (USA 2010)
Meine Besprechung der TV-Serie „The Walking Dead – Staffel 2“ (USA 2011/2012)
Meine Besprechung der TV-Serie “The Walking Dead – Staffel 3″ (USA 2013)
Kriminalakte: das Comic-Con-Panel zur TV-Serie
“The Walking Dead” in der Kriminalakte
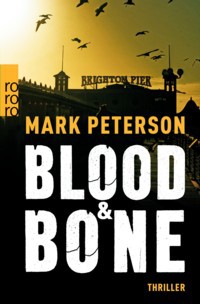



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB