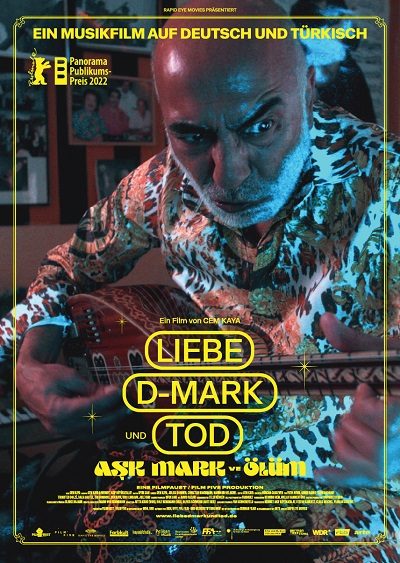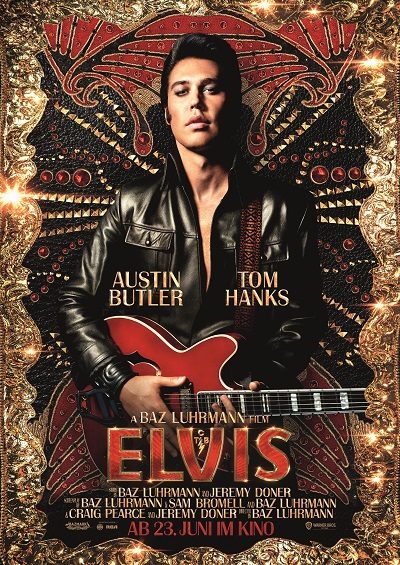„Bob Marley: One Love“ gehört zu den Biopics, die nicht das gesamte Leben eines Menschen von der Wiege bis zur Bahre schildern, sondern die sich auf einen kurzen entscheidenden Abschnitt im Leben des Porträtierten konzentrieren. „Selma“ war so ein Biopic.
Reinaldo Marcus Green, der zuletzt das Biopic „King Richard“ (über Richard Williams und seine Töchter Venus und Serena Williams) inszenierte, beginnt sein Bob-Marley-Biopic Ende 1976. Jamaika versinkt im nachkolonialen Bürgerkriegschaos. Bob Marley, schon damals ein Star, möchte mit einem Friedenskonzert zur Versöhnung aufrufen. Politisch ist das selbstverständlich unglaublich naiv. Aber Bob Marley ist ein Künstler und ein gläubiger Rastafari. Am 3. Dezember 1976, zwei Tage vor dem Smile Jamaica Concert, wird in seinem Haus in Kingston ein Anschlag auf ihn verübt. Neben ihm werden seine Frau Rita, sein Manager Don Taylor und der Band-Assistent Louis Griffiths teils schwer verletzt. Wie durch ein Wunder überleben alle.
Nach dem Konzert verlässt Bob Marley die Insel. Der Druck ist zu groß. Seine Frau Rita und seine Kinder schickt er in die USA zu Verwandten (und ziemlich vollständig aus der Filmgeschichte). Er selbst fliegt mit seiner Band, den Wailers, nach London. Dort nimmt er seine nächste Platte auf. „Exodus“ wird am 3. Juni 1977 veröffentlicht und ein riesiger Erfolg. Bob Marley wird noch populärer.
Er tourt durch die Welt. Sein Wunsch, auch in Afrika zu spielen, verwirklicht sich in dem Moment noch nicht.
Am 22. April 1978 kehrt er zu einem weiteren Friedenskonzert, dem One Love Peace Concert, nach Jamaika zurück.
Diese beiden Konzerte bilden in Greens Film die erzählerische Klammer.
Dazwischen gibt es viele Episoden und Musik, aber es wird nie klar, was Green an genau diesem Teil aus Bob Marleys Leben interessiert. Alle damit zusammenhängenden potentiell interessanten Fragen werden vermieden. Es gibt auch keine Perspektive auf Marleys Leben, die das präsentierte Material irgendwie ordnen würde. Entsprechend ziellos plätschert das Biopic zwischen Episoden aus Marleys Familienleben, Proben und Abhängen mit seiner Band, Auftritten und Gesprächen mit Vertrauten und zusammenhanglos eingestreuten Rückblenden vor sich hin.
Dabei hätten diese anderthalb Jahre das Potential gehabt, eine interessante Geschichte zu erzählen. Green hätte erzählen können, wie es ist, wenn man aus seiner Heimat flüchten muss und wieder zurückkehren und Frieden stiften möchte. Oder wie es ist, wenn man plötzlich von einem weltweit bekannten Star, der schon damals in Jamaika gottgleich verehrt wurde, zu einem Superstar wird und man so zu einer einflussreichen Stimme wird. Oder wenn man von Freunden ausgenutzt und Vertrauen missbraucht wird. Oder wie ein Künstler, der in London auf Punk-Musiker trifft, sich mit seinem neuen Werk neu erfinden möchte. Oder über seine Beziehung zu seiner Frau. Das alles wird in „Bob Marley: One Love“ kurz angesprochen, aber nie konsequent vertieft.
Stattdessen rückt mit zunehmender Filmzeit die Rastafari-Religion immer mehr in den Mittelpunkt. Allerdings auf einem so plakativen und nervigem Niveau, das wir sonst nur aus unerträglichen christlichen Faith-based-Movies kennen.
Am Ende ist „Bob Marley: One Love“ nur, mit einigen Auslassungen, die Verfilmung einiger Zeilen aus dem Wikipedia-Artikel über Bob Marley. Garniert wird die Bilderbuch-Zusammenstellung nicht zusammenhängender Ereignisse mit vielen Bob-Marley-Songs, die im Film von Bob Marley gesungen werden.

Bob Marley: One Love (Bob Marley: One Love, USA 2024)
Regie: Reinaldo Marcus Green
Drehbuch: Terence Winter, Frank E. Flowers, Zach Baylin, Reinaldo Marcus Green (nach einer Geschichte von Terence Winter und Frank E. Flowers)
mit Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Umi Myers, Anthony Welsh, Nia Ashi, Aston Barrett Jr., Anna-Sharé Blake, Gawaine „J-Summa” Campbell, Naomi Cowan, Alexx A-Game, Michael Gandolfini, Quan-Dajai Henriques, Hector Roots Lewis, Abijah „Naki Wailer” Livingston, Nadine Marshall, Sheldon Shepherd, Andrae Simpson, Stefan A.D Wade
Länge: 108 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Hinweise
Moviepilot über „Bob Marley: One Love“
Metacritic über „Bob Marley: One Love“
Rotten Tomatoes über „Bob Marley: One Love“
Wikipedia über „Bob Marley: One Love“ (deutsch, englisch) und Bob Marley (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Reinaldo Marcus Greens „King Richard“ (King Richard, USA 2021)
–
Bonushinweise
Am Freitag, den 16. Februar, zeigt Arte um 21.45 Uhr die Doku „Marley“ (USA/Großbritannien 2012) und danach um 00.05 Uhr „Bob Marley: Uprising Live!“ (Deutschland 1980). Das Konzert wurde am 13. Juni 1980 in der Dortmunder Westfalenhalle für den „Rockpalast“ aufgenommen.
Wahrscheinlich die bessere Wahl, die auch danach einige Tage in der Mediathek (Folge den Links) verfügbar ist.
–
Bob Marley live 1977 in London im Rainbow Theatre.
Bob Marley live 1980 in der Dortmunder Westfalenhalle



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB