

Nachdem der alljährliche „Der deutsche Krimi ist schlecht und der Regionalkrimi ist noch schlechter“-Artikel dieses Jahr von Lisa Kuppler, die es eigentlich besser wissen müsste, in der FAZ erschien und es gleich einige geharnischte Kommentare gab (unter anderem Der Schneeman, CrimeNoir, Crimemag und Polar), erspare ich mir jede weitere Kommentierung (aber man könnte die bekannte „Der Regionalkrimi ist doof“-Melodie doch wenigstens mal etwas variieren) und wende mich den Sammelbänden „Secret Service – Jahrbuch 2015“ von der deutschsprachigen Krimiautorenvereinigung „Das Syndikat“ und dem Sammelband „Krimimagazin: Crime & Sex“ von Tobias Gohlis und Thomas Wörtche zu.
Im „Krimimagazin: Crime & Sex“ versammeln die beiden Krimikritiker neun Texte von Krimiautoren. Drei Frauen, sechs Männer. Drei Deutsche, sechs, hm, Ausländer.
Und auch nach der Lektüre kann ich immer noch nicht sagen, wer es kaufen soll und was die Absicht des Sammelbandes ist. Das heißt jetzt nicht, dass die Texte vollkommen uninteressant sind. Es sind Ergänzungen zu den von den Autoren geschriebenen Romanen, die teilweise schon etwas älter sind. Es handelt sich um Hintergrundmaterial und damit klassisches Material für ein Nachwort.
So schreibt Gary Dexter („Der Marodeur von Oxford“, Penser Pulp 2013) in „Kriminalliteratur und Sexologie: Bettgenossen des 19. Jahrhunderts“ über Krimis (viel Sherlock Holmes) und Sexologen im 19. Jahrhundert. Das liest sich eher wie ein Lexikonartikel.
Auch Wolfgang Kaes‘ Ausführungen über Stalking und die nicht mehr aktuelle Gesetzeslage in Deutschland lesen sich wie ein Lexikonartikel. Kaes (zuletzt „Spur 24“, rororo 2014) schrieb darüber in „Herbstjagd“ (2006).
Mechtild Borrmann schreibt über Zwangsprostitution am Beispiel einer Prostituierten. Das Porträt basiert auf ihren Recherchen für „Die andere Hälfte der Hoffnung“ (Droemer Verlag, 2014) und verrät einem informiertem Zeitungsleser nichts Neues.
María Inés Krimer („Sangre Kosher: Ruth Epelbaum und die Zwi Migdal“, Penser Pulp 2014) schreibt über Prostitution in Argentinien, gestern (viel und interessant) und heute.
Andrew Brown (zuletzt „Trost“, btb 2014) erzählt eine Episode aus seinem Alltag als Polizist mit einer Straßenprostituierten.
Carlo Lucarelli (zuletzt „Bestie“, Folio 2014) redet über den italienischen Mann und das Verbrechen in Italien, also vor allem die Mafia. Das Interview ist ein netter Einblick in die italienische Seele.
Liza Cody liefert einige Hintergründe zu ihrem letzten Roman „Lady Bag“ (ariadne, 2014). Sie porträtiert vier obdachlose Frauen, die sie zu dem Roman inspirierten und dieser gut geschriebene Text macht wirklich neugierig auf „Lady Bag“.
Howard Linskey schreibt über das Geschäft mit der Prostitution in England, das auch in seinen Romanen „Crime Machine“ (Knaur 2012), „Gangland“ (Knaur 2014) und „Killer Instinct“ (Knaur, angekündigt für August 2015) eine Rolle spielt.
Und Frank Göhre begibt sich wieder auf die sündige Meile St. Pauli. Darüber hat er mehrere Romane geschrieben und in diversen Nachworten und Essays auch über die wahren Hintergründe seiner Geschichten geschrieben. Trotzdem gelingt es ihm in „Palais d’Amour“ einige Aspekte anzusprechen, die auch für einen Göhre-Fan noch neu sind.
Aber in den Sammelband fehlt jede kritische Betrachtung oder Einordnung von ihren Romanen (was auch nicht die Aufgabe des Autors ist) oder des Themas „Sex und Verbrechen“ in die Geschichte der Kriminalliteratur. Es gibt, was man bei den beiden Herausgebern eigentlich hätte erwarten können, keinen einzigen Text, der sich mit der Darstellung von Kriminalität und Sexualität im Kriminalroman beschäftigt und was die Behandlung von Sex und Verbrechen in der Literatur über die Wirklichkeit aussagt.
In den Essays geht es fast immer nur um Prostitution in der Wirklichkeit in verschiedenen Ländern in der Vergangenheit und der Gegenwart, mal mit mehr, mal mit weniger Informationen über die Verbindung vom Sexgewerbe zum Verbrechen. Man erfährt auch etwas über den dortigen Sittenwandel. Aber ohne die Kenntnis der Romane hängen die Texte fast alle im luftleeren Raum, oft sind sie nicht sonderlich spannend geschrieben und allzu neugierig wurde ich nicht auf die meisten Romane.
Immerhin gelingt es Liza Cody, Howard Linskey und Frank Göhre, die alle auch sagen, wie die Wirklichkeit ihre Romane inspirierte, neugierig auf ihre Romane zu machen. Und das wäre nach „drei Frauen“ und „drei Deutsche“ das dritte Trio.
Für Februar 2016 ist mit „Crime & Money“ das zweite Krimimagazin angekündigt, das dann hoffentlich mehr als ein schlechter „True Crime“-Sammelband ist.
–
Das Zielpublikum von „Secret Service – Jahrbuch 2015“ des Syndikats ist dagegen ganz klar umrissen: die Mitglieder des Syndikats und deutschsprachige Krimiautoren. Für sie gibt es die bewährte Mischung aus Klatsch und Tratsch, vulgo Vereinsmeierei. Es gibt einige Kurzkrimis, die ungefähr die Länge eines Witzes haben, Veranstaltungsberichte (über die Wiener Kriminacht, die Criminale und das Forum Criminale; beides lesenswert), Hintergrundinformationen (über E-Books und Lesungen), Ratschläge und, von Thomas Przybilka (der auch wichtige Sekundärliteratur auflistet), die immer interessanten Befragungen der Glauser-Preisträger. Dieses Jahr sind es die 2014er Preisträger Judith W. Taschler (für „Die Deutschlehrerin“ als bester Roman), Harald Gilbers (für „Germania“ als bestes Debüt), Verleger Herman-Josef ‚Hejo‘ Emons (Ehrenglauser für besondere Verdienste), Alexander Pfeiffer (für „Auf deine Lider senk ich Schlummer“ als bester Kurzkrimi) und Alice Gabathuler (für „NO_WAY_OUT“ als bester Kinder- und Jugendkrimi).
Und dann gibt es, immer wieder, Texte, die mich kopfschüttelnd zurücklassen, wie Renate Klöppels „Lampenfieber bei Lesungen: Ein Übel, mit dem man sich abfinden muss?“. Anstatt wirklich sinnvolle Hinweise zu geben oder zu erzählen, wie eine Lesung funktioniert, plaudert sie ein wenig und die Tipps sind höchstens für Schüler, die zum ersten Mal ein Referat halten sollen, tauglich. Denn – und hier kommen meine Tipps für Lesungen – als Autor hat man im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die etwas präsentieren, einige Vorteile: die Leute sind wegen einem gekommen, sie sind höflich und interessiert und sie wollen den Autor umschmeicheln. Sie werden also keine unhöflichen Fragen stellen oder einen kritisieren. Man hat schon einen Text, den man einfach nur vorlesen muss. Niemand erwartet, dass ein Autor ein guter Vorleser ist. Er sollte einfach seinen Text langsam und laut (wenn es kein Mikrophon gibt) vorlesen und danach einfach schon einmal die offensichtlichen Fragen (Woher haben Sie ihre Ideen? Warum haben Sie diesen Roman geschrieben? Wie sieht ihr Arbeitstag aus? Hat Hollywood schon wegen der Verfilmung angefragt?) beantworten. Dabei kann er sich viel Zeit lassen. Denn die Leute wollen ihm zuhören. Sie werden ihn nicht unterbrechen. Und, wie gesagt, sie sind höflich. Sie klatschen. Sie lachen. Sie freuen sich, dass der Autor sie beehrt. Am Ende signiert man die Bücher.
Außerdem sollte jeder Autor vor seiner ersten Romanveröffentlichung – immerhin haben sie fast alle studiert – schon einige Vorträge vor Publikum gehalten haben. In der Schule (die blöden Referate), in der Universität (die blöden Referate) und im Beruf (die blöden Referate).
Über Horst-Dieter Radkes Behauptung „Die Protagonisten der meisten aktuellen Romane haben keine Biographie.“ in „Über das Grab hinaus… – Von Krimiklassikern lernen“ lohnt es sich kaum zu streiten. Er nennt dann Dorothy L. Sayers‘ Lord Peter Wimsey, Agatha Christies Miss Marple und Hercule Poirot und George Simenons Kommissar Maigret als Charaktere mit einer ausgefeilten Biographie.
Der Leser aktueller Romane denkt an Lawrence Blocks Matt Scudder, James Lee Burkes Dave Robicheaux, Michael Connellys Harry Bosch, Ian Rankins John Rebus, Robert B. Parkers Jesse Stone, Ken Bruens Jack Tayler, und ehe ihm weitere Ermittler mit einer ausgewachsenen Biographie, die sich über mehrere Romane entwickelt, einfallen, beschließt er, den Text zu vergessen.
In „Großleinwandthriller oder: Warum machst du eigentlich kein Kino?“ schreibt Matthias Herbert über seine Erfahrungen bei der (Nicht-)Realisierung eines Spielfilms. Das ist amüsant geschrieben und bietet einen ernüchternden Einblick in die deutsche Filmszene.
Insgesamt zeigt „Secret Service – Jahrbuch 2013“, wie die vorherigen Ausgaben, warum der deutsche Krimi ist, wie er ist.
–
Tobias Gohlis/Thomas Wörtche (Herausgeber): Krimimagazin: Crime & Sex
Droemer, 2015
240 Seiten
9,99 Euro
–
Syndikat: Secret Service – Jahrbuch 2015
Gmeiner, 2015
256 Seiten
9,99 Euro
–
Hinweise
Homepage vom Syndikat
Meine Besprechung von „Secret Service – Jahrbuch 2009“
Meine Besprechung von „Secret Service – Jahrbuch 2011“
Meine Besprechung von „Secret Service – Jahrbuch 2012“
Meine Besprechung von „Secret Service – Jahrbuch 2013“
Meine Besprechung von „Secret Service – Jahrbuch 2014“
Gefällt mir Wird geladen …
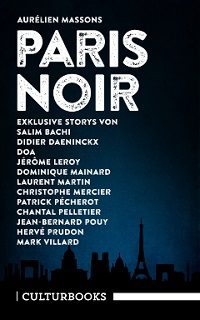



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB 









