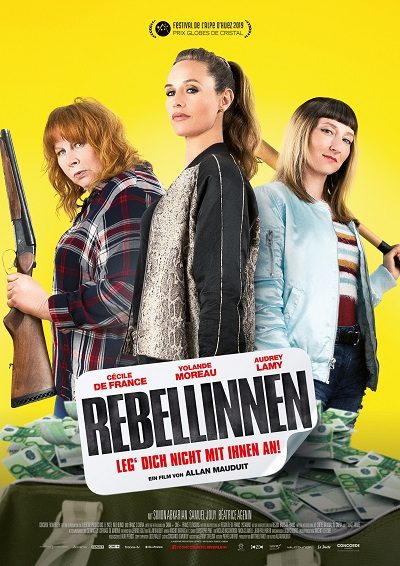Cathy Marie (Audrey Lamy) hat genug von ihrer Chefin. Die betreibt ein nobles Sterne-Restaurant, hat im Fernsehen eine erfolgreiche Kochshow und einen Kontrollfetisch. In ihrem Restaurant werden nur ihre Kreationen in der von ihr gewünschten Zubereitung hergestellt. Cathy bereitet es anders zu und wird dafür von ihrer Chefin heruntergeputzt. Verärgert kündigt sie. Die Vierzigjährige denkt sich, dass sie mit ihrem Lebenslauf schnell in einem anderen Nobelrestaurant angestellt wird.
Dem ist nicht so. Fast schon verzweifelt bewirbt sie sich auf eine Anzeige, die, wie sie schon beim ersten Blick auf das heruntergekommene, abseits gelegene Gebäude feststellt, etwas blumig formuliert wurde. Die angekündigte Küche ist nicht etwas, sondern weit unter ihrem Niveau. Angesichts ihrer hoffnungslosen Lage nimmt sie die Stelle als Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge trotzdem an.
Schockiert bemerkt sie an ihrem ersten Tag, dass die Zubereitung des Essens hier aus dem Erhitzen von vorgefertigten Zutaten besteht. Das wird sie ändern. Auch wenn ihr der Leiter des Hauses erklärt, für ein besseres Essen reiche das Geld nicht und die Jugendlichen seien zufrieden mit der Dosenravioli, solange sie warm ist und pünktlich auf dem Tisch steht.
„Die Küchenbrigade“ ist der neue Film von Louis-Julien Petit. Sein letzter Film war das warmherzige, äußerst gelungene Drama „Der Glanz der Unsichtbaren“ über eine von der Schließung bedrohte Tagesstätte für obdachlose Frauen.
Dieses Mal stehen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Mittelpunkt des Films. Wenn sie nicht vor ihrem 18. Geburtstag eine Ausbildung beginnen, werden sie abgeschoben. Diese Flüchtlinge werden, wie die Frauen im „Glanz der Unsichtbaren“, von Laien gespielt, die sich letztendliche selbst spielen.
Trotz all der Probleme, die die Figuren in dem Film haben, und die auch angesprochen werden, erzählt Petit die Geschichte als Feelgood-Movie mit einer begrüßenswerten Botschaft.
Das Problem des Films ist nur, wie sie hier präsentiert wird. Deshalb ist „Die Küchenbrigade“ eine Sozialkomödie, die nicht so gelungen wie sein vorheriger Film ist.
Natürlich muss in einem Film einiges verdichtet und zugespitzt werden. So ist das Essen in dem Heim überirdisch schlecht. Es gibt sehr wenig, eigentlich überhaupt kein Personal. Das Haus ist riesig, aber nur wenige Zimmer werden bewohnt. Das alles muss man im Rahmen der Konventionen eines humoristischen Feelgood-Dramas hinnehmen. Ebenso dass alle sehr schnell bei der im zwischenmenschlichen Umgang schwierigen Cathy Kochen auf höchstem Niveau lernen wollen.
Ärgerlich wird es am Ende des Film. Sobald Cathy sich um einen Auftritt in der Kochshow ihrer früheren Chefin bewirt, wird die Geschichte unglaubwürdig. Das live ausgestrahlte Finale der Kochshow, in der Cathy zu den Finalisten gehört, ist eine einzige Abfolge unplausibler und nur scheinbar überraschender Wendungen. Dieser Teil wirkt, als habe das Team einer Daily-Soap die Macht am Set übernommen.
„Die Küchenbrigade“ gehört, mit Lamby und Cluzet in den Hauptrollen, zum sozial bewusstem französischem Starkino. Öfter wirkt es so, als würde das Schicksal der Flüchtlinge für den Film ausgebeutet. Sie dürfen irgendwann im Film kurz aus ihrem Leben erzählen, aber im Mittelpunkt steht die biestige Cathy mit ihren Problemen. Und das Finale folgt der sich nicht um Realismus kümmernden Dramaturgie schlechter US-amerikanischer Feelgood-Movies.

Die Küchenbrigade (La brigade, Frankreich 2022)
Regie: Louis-Julien Petit
Drehbuch: Louis-Julien Petit, Liza Benguigui-Duquesne, Sophie Bensadoun, Thomas Pujol (in Zusammenarbeit mit) (nach einer Idee von Sophie Bensadoun)
mit Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo
Länge: 97 Minuten
FSK: ab 0 Jahre
–
Hinweise
Moviepilot über „Die Küchenbrigade“
AlloCiné über „Die Küchenbrigade“
Rotten Tomatoes über „Die Küchenbrigade“
Wikipedia über „Die Küchenbrigade“ (deutsch, französisch)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB