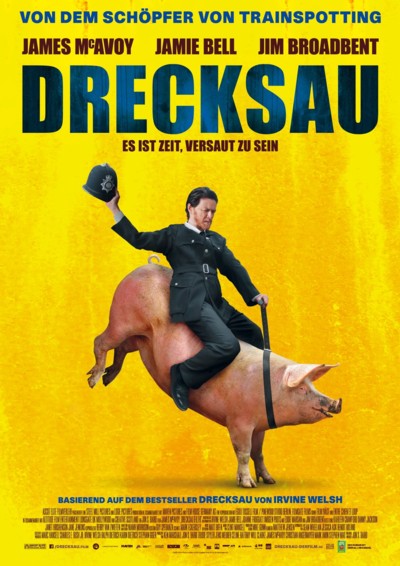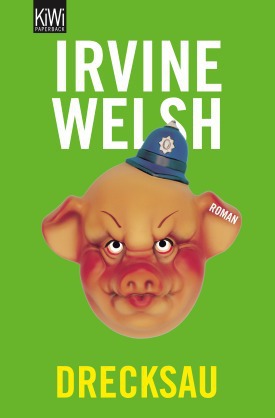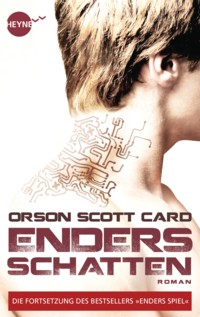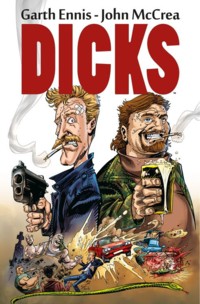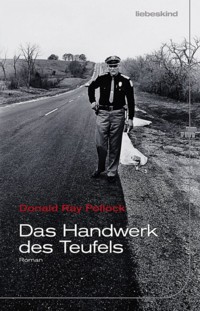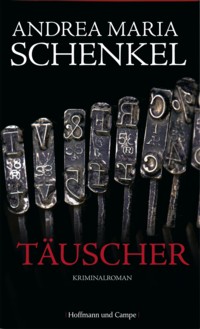Für alle, die die die letzten Jahre weltweit grassierende Stieg-Larsson-Manie, inclusive zwei Verfilmungen von seinem Debütroman „Verblendung“, ignorieren konnten, gibt es jetzt eine kurze Zusammenfassung von „Verblendung“. Denn inzwischen ist auch der zweite und abschließende Teil von Denise Minas Comic-Adaption des Bestsellers auf Deutsch erschienen.
Der alte Firmenchef Henrik Vanger beauftragt den Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist, der gerade wegen einer vollkommen verpatzten Enthüllungsgeschichte mächtig Ärger hat, Womanizer und exzessiver Kaffeetrinker ist (Hat schon irgendjemand eruiert, wie viel Kaffee in Larssons „Millennium“-Romanen getrunken wird?), herauszufinden, wer 1966 seine Nichte Harriet auf der der Familie gehörenden Insel ermordete. Blomkvist beginnt mit dem Aktenstudium.
Für die Comic-Adaption hat die mit dem John-Creasey-Dagger ausgezeichnete Krimi-Autorin Denise Mina das Dickicht des Romans etwas gelichtet und einige Kleinigkeiten geändert. Aber in weiten Teilen folgt sie, wie von den Fans gewünscht, fast schon sklavisch, Stieg Larssons Roman.
Jedenfalls endete der erste Teil der Comic-Adaption mit Lisbeth Salander, die ihren Vormund tätowiert, und Mikael Blomkvist, der – früher als im Roman – seine Haftstrafe für die missglückte Enthüllungsgeschichte antritt.
Der zweite Teil beginnt nach Blomkvists Haft. Er ist wieder zurück auf der Insel, lernt Lisbeth Salander, die geniale, beziehungsgestörte Hackerin, die schon seinen gesamten Computer hackte, kennen und gemeinsam beginnen sie Harriet Vangers mysteriöses Verschwinden aufzuklären. Dabei stoßen sie auf eine Mordserie, die nach dem 2. Weltkrieg begann und sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Sie glauben, dass die Frauenmorde von einem Vater-Sohn-Paar begangen werden, das zur Familie Vanger oder ihrem engsten Umfeld gehört, und dass Harriet die Mörder kannte.
Auch der zweite und abschließende Teil von „Verblendung“ folgt dem Roman ziemlich genau, wobei die Nazi-Geschichte vollkommen fehlt und die Recherchen von Blomkvist und Salander auf wenigen Seiten eingedampft werden, während die Folterung Blomkvists durch den Mörder und Salanders Reaktion darauf (es könnte ja noch zwei Menschen auf dem Planeten geben, die das Ende nicht kennen) viele Seiten einnehmen und es danach – wie in dem Roman – ein elend langes Nachspiel gibt, in dem alle offenen Fragen und einige Fragen, die man nicht stellte, beantwortet werden.
Insgesamt gelang Mina eine gelungene, aber nicht besonders eigenständige Adaption, die – wie die Verfilmungen – weitgehend dem von Stieg Larsson erfundenem Handlungsgerüst folgt.
Die Comic-Adaption von Stieg Larssons zweitem Roman „Verdammnis“ ist schon angekündigt.
–
Denise Mina (Autor)/Leonardo Manco/Andrea Mutti (Zeichner): Stieg Larsson – Millennium: Verblendung – Band 2
(übersetzt von Joachim Körber)
Panini, 2013
164 Seiten
16,99 Euro (Softcover)
24,99 Euro (Hardcover)
–
Originalausgabe
The Girl with the Dragoon Tattoo – Book Two
Vertigo/DC Comics, 2013
–
Vorlage
Stieg Larsson: Verblendung
(übersetzt von Wibke Kuhn)
Heyne, 2011 (Movie-Tie-In zur Fincher-Version)
704 Seiten
9,99 Euro
–
Originalausgabe
Män son hatar kvinnor
Norsteds Förlag, Stockholm 2005
–
Deutsche Erstausgabe
Heyne, 2006
–
Verfilmungen
Verblendung (Män som hatar kvinnor, Schweden/Deutschland/Dänemark 2009)
Regie: Niels Arden Oplev
Drehbuch: Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg
LV: Stieg Larsson: Män son hatar kvinnor, 2005 (Verblendung)
mit Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Peter Haber, Sven-Bertil Taube, Peter Andersson, Ingvar Hirdwall, Marika Lagercrantz, Björn Granath
–
Verblendung (The Girl with the Dragon Tatoo, USA 2011)
Regie: David Fincher
Drehbuch: Steve Zaillian
LV: Stieg Larsson: Män son hatar kvinnor, 2005 (Verblendung)
mit Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff, Robin Wright, Yorick van Wageningen, Joely Richardson, Geraldine James, Goran Visnjic, Julian Sands
–
Hinweise
Mullholland Books: Interview mit Denise Mina über “Verblendung” (12. November 2012)
Meine Besprechung von Stieg Larssons „Verblendung“ (Buch und Film)
Meine Besprechung von Stieg Larssons „Verdammnis“ (Buch und Film)
Meine Besprechung von Stieg Larssons „Vergebung“ (Buch/Film)
Krimi-Couch über Stieg Larsson
Wikiepedia über Stieg Larsson (deutsch, englisch)





 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB