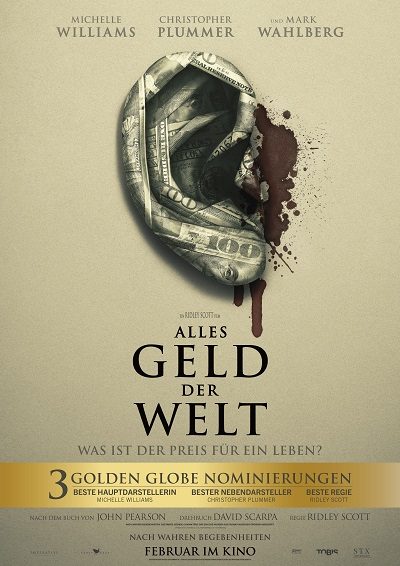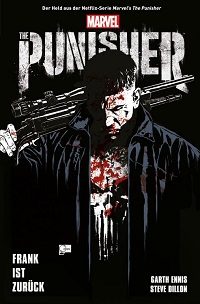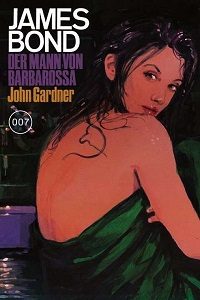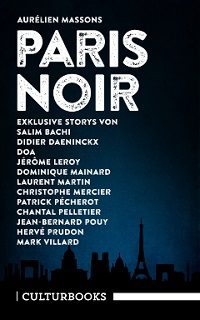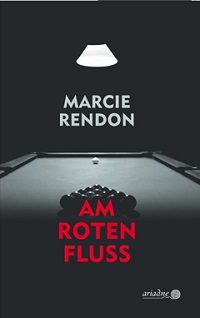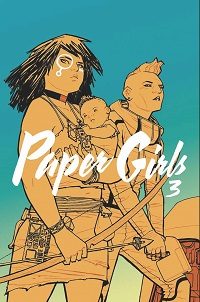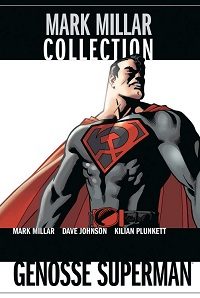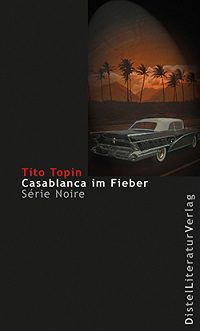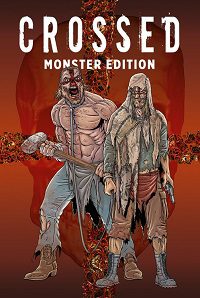In der Realität die wir aus den Nachrichten kennen, sind russische Spione alte Männer mit dem Sex-Appeal einer vertrockneten Büropflanze.
In der Fiktion sehen Spione besser aus. Zum Beispiel wie Jennifer Lawrence. Und auch die Seite der Männer ist mit Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons und Ciarán Hinds sehr präsentabel besetzt. Sie spielen alle wichtige Rollen in der Verfilmung von Jason Matthews‘ Agententhriller „Red Sparrow“, der 2013 im Original erschien. 2015 gab es eine deutsche Übersetzung. Der Thriller erhielt den Edgar und den ITW Thriller Award als bester Debütroman. Die Filmrechte verkaufte er bereits vor der Publikation von „Red Sparrow“ für eine, so wird gesagt, siebenstellige Summe an Hollywood.
Der Thriller kann als eine Mischung aus Ian Fleming und John le Carré beschrieben werden. Wobei er von Fleming das Pulpige und den Sex, aber nicht das Mondäne und die Action übernommen hat. Im Roman gibt es keine Action und auch im Film muss man die Actionszenen mit der Lupe suchen. Von le Carré übernahm Matthews die komplizierten Spiegelfechtereien der Nachrichtendienste mit ihren Doppelagenten und Landesverrätern und das Wissen um die Arbeit von Geheimagenten, die er sehr akkurat beschreibt.
Das verwundert wenig. Denn vor seiner Karriere als Autor war Matthews 33 Jahre CIA-Agent.
Seit der Veröffentlichung von „Red Sparrow“ schrieb Matthews zwei weitere, bislang nicht übersetzte Agententhriller mit den Charakteren aus „Red Sparrow“; also, denen, die den Roman überleben. Damit ist genug Material für zwei weitere Filme vorhanden.
In „Red Sparrow“ geht es in schönster Agententhrillertradition um die Jagd nach einem Doppelagenten.
Die Geschichte beginnt in Moskau. Nachts trifft CIA-Agent Nate Nash (Joel Edgerton) MARBLE, einen hochrangigen SWR-Mann, der schon seit Jahren den Amerikanern brisantes Material übergibt. Zufällig werden sie bei ihrem Treffen durch eine Patrouille gestört. Nash gelingt es, die Flucht von MARBLE zu decken und mit dem brisanten Material vor seinen Verfolgern in die US-Botschaft zu flüchten.
In dem Moment weiß der russische Auslandsnachrichtendienst SWR, dass sie einen Verräter in den eigenen Reihen haben. Der Erste Stellvertretende Direktor Vanya Egorova (Matthias Schoenaerts) schlägt vor, seine Nichte auf Nash anzusetzen. Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) ist eine ehemalige Balletttänzerin, die er nach einem Tanzunfall mit einem Angebot erpresste, das sie nicht ablehnen konnte: wenn sie ihm hilft, kann ihre kranke Mutter weiterhin in der Wohnung leben und sie wird medizinisch versorgt werden. Dominika ist einverstanden. Auf einer abgelegenen Schule wird sie zu einem ‚Sparrow‘ ausgebildet. Das sind Spione, die Sex einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Im Buch gibt es etliche Sex-Szenen. Der Film ist da, trotz einiger für einen Hollywood-Mainstream-Film erstaunlich offenherziger Szenen, deutlich prüder geraten.
In Budapest (im Buch Helsinki) trifft sie Nash. Während sie versucht, von ihm Informationen über den Verräter zu erhalten, versucht Nash sie als Informantin zu gewinnen. Dabei, was ein Bruch mit allen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln ist, verlieben sie sich ineinander.
Justin Haythe hatte die undankbare Aufgabe, aus dem gut siebenhundertseitigem Roman eine Geschichte herauszudestillieren, die in zwei Stunden erzählt werden kann. In seinem Drehbuch ließ er vor allem einige Subplots und Episoden aus dem Agentenleben weg, kürzte und verdichtete sie. Das ist okay, weil der Roman sich teilweise wie die Vorlage für eine Mini-Agentenserie liest und daher teilweise arg vor sich hin plätschert. Da wird dann der Hauptplot mal links liegen gelassen, um ausführlich die Geschichte einer Senatorin, die den Russen Top-Secret-Informationen verkauft, zu erzählen. Im Film kommt sie als Komposition von zwei Buchcharakteren. Zwei Buchplots werden im Film zu einem Plot, der eigentlich nur aus einer Szene besteht, in der Mary-Luise Parker als Schnapsdrossel ihr komödiantisches Talent ausspielen kann. Eine andere Änderung ist, dass im Film die Identität von MARBLE viel später als im Buch enthüllt wird. Hier spielt Haythe, wie öfter, mit überraschenden Wendungen und Enthüllungen, während Matthews in seinem Roman für den Leser die Karten immer sehr früh aufdeckt. Die Spannung entsteht aus dem Wissen um die Pläne der verschiedenen Agenten, wie sie gegeneinanderprallen und was aus diesem Zusammenprall entsteht.
Am Filmende gibt es eine große Abweichung vom Buchende, die eine große Schwäche von Francis Lawrences Film offenlegt. Lawrence gelingt es nicht, sich zu entscheiden, welchen Konflikt er in den Mittelpunkt seiner Coming-of-Age-Geschichte stellen will. Über weite Strecken des Films folgt er der umfangreichen und verzweigten Romangeschichte, ohne den Mut zu finden, den Film auf schlanke zwei Stunden zu kürzen. So ist „Red Sparrow“ mit 140 Minuten länger als nötig geraten. Zu oft plätschert die Geschichte vor sich hin. Die Charaktere sind für einen Agententhriller der le-Carré-Schule zu eindimensional. Die sexy Spionin, die Sex und Kampfkunst miteinander verbindet, ist schön anzusehen, aber nicht abendfüllend. Die Doppelspiele der Spione mit ihren Landesverrätern, Doppelagenten und Intrigen sind dann doch nicht so reizvoll. Jedenfalls wenn unklar ist, ob eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Rachegeschichte, eine Liebesgeschichte oder eine traditionelle Agentengeschichte mit viel Verrat und Gegenverrat bei der Suche nach einem Verräter im Mittelpunkt stehen soll.
Am Ende ist „Red Sparrow“ die zu lang geratene, sehr gediegene Version eines Pulp-Agententhrillers, in der Lawrence nach drei „Tribute von Panem“-Filmen Jennifer Lawrence wieder sehr fotogen in Szene setzt.

Red Sparrow (Red Sparrow, USA 2018)
Regie: Francis Lawrence
Drehbuch: Justin Haythe
LV: Jason Matthews: Red Sparrow, 2013 (Operation Red Sparrow, Red Sparrow)
mit Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Ciarán Hinds, Joely Richardson, Bill Camp, Jeremy Irons, Thekla Reuten, Sakina Jaffrey, Sebastian Hulk
Länge: 141 Minuten
FSK: ab 16 Jahre
–
Die Vorlage

Jason Matthews: Red Sparrow
(übersetzt von Michael Benthack)
Goldmann, 2018
672 Seiten
9,99 Euro
–
Deutsche Erstausgabe
Operation Red Sparrow
Goldmann, 2015
–
Originalausgabe
Red Sparrow
Scribner, Simon & Schuster, New York, 2013
–
Hinweise
Rotten Tomatoes über „Red Sparrow“
Wikipedia über „Red Sparrow“ (deutsch, englisch) und Jason Matthews



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB