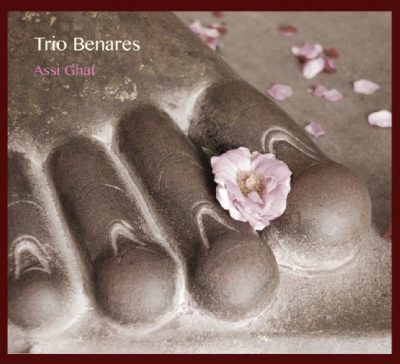Alle paar Jahre dreht der bekennende Katholik Martin Scorsese einen Film, bei dem der Glaube im Mittelpunkt steht und sich alles darum dreht. „Die letzte Versuchung Christi“ war ein veritabler Skandal und eine spannende Neuinterpretation von Jesus Christus und seinen letzten Tagen. „Kundun“ war ein bestenfalls schöner Bilderbogen über die Kindheit und Jugend des vierzehnten Dalai Lama. Und jetzt „Silence“, die Verfilmung eines japanischen Romans von 1966, den er 1988 las und seitdem verfilmen wollte. Die Shusaku-Endo-Verfilmung ist, wenn man nicht gerade in einer Glaubenskrise steckt oder ein brennendes Interesse an theologischen Fragen hat, ein erschreckend langweiliger Film, der sein Thema auf die denkbar uninteressanteste Art behandelt.
1637 erhalten Pater Sebastiao Rodrigues (Andrew Garfield) und Pater Francisco Garpe (Adam Driver) in Portugal die Nachricht, dass in Japan der geachtete Jesuitenpater Cristovao Ferreira (Liam Neeson) vom Glauben abgefallen und zum Buddhismus konvertiert ist. Er soll sogar eine Japanerin geheiratet haben. Seine beiden Schüler Rodrigues und Garpe wollen das nicht glauben. Sie wollen im Namen des Ordens die Nachricht überprüfen. Und nebenbei etwas missionieren.
In Japan findet derweil eine historisch verbürgte Christenverfolgung statt. Christen werden gefoltert und gemartert, bis sie ihrem Glauben abschwören oder sterben. Trotzdem praktizieren einige Christen im Untergrund weiterhin ihren Glauben.
Rodrigues und Garpe treffen in Japan kurz nach ihrer Ankunft auf eine solche Gemeinde. Sie beginnen dort als Geistliche zu praktizieren. Gleichzeitig suchen sie weiter nach dem anscheinend spurlos verschwundenen Ferreira.
Auf ihrer Reise treffen sie auch auf den gefürchteten Inquisitor Inoue (Issey Ogata). Mit salbungsvollen Worten und dem Angebot, keine weiteren Gläubigen bis zu ihrem Tod zu foltern, will er Pater Rodriques überzeugen, seinem Glauben abschwört. Sein Kollege und Freund Garpe wurde schon von Inoues Leuten getötet. Rodrigues, der sich in seiner christlichen Überzeugung nicht erschüttern lässt und sich immer wieder als Wiedergänger von Jesus Christus sieht, trifft auch auf Ferreira. Das ist der erwartbare Höhepunkt des Films. Wie in „Apocalypse Now“ der Auftritt von Marlon Brando am Filmende. Aber während Coppolas Vietnam-Film eine Reise in das Herz der Finsternis war, ist Scorseses Film eine, zugegeben optisch sehr ansprechende, Reise in das Herz der Langeweile. Denn die im Zentrum stehende Frage, warum der allseits geachtete, tiefgläubige Ferreira dem Glauben abschwor, während andere Gläubige auch unter einer immer schlimmer werdender Folter an ihrem christlichen Glauben festhielten, wird in „Silence“ als eine rein theologische und philosophische Frage für die verfolgten Jesuiten betrachtet. Die historischen Hintergründe werden, abseits der detailgenauen Nachstellung des damaligen Lebens, nicht weiter beachtet.
Scorsese und sein langjähriger Drehbuchautor Jay Cocks („Zeit der Unschuld“, „Gangs of New York“) reduzieren den Glaubenskonflikt letztendlich auf eine rein utilitaristische Frage: Wie viele Christen sollen für meinen Glauben sterben? Das ist dann, über hundertsechzig Minuten, eine arg eingeschränkte Behandlung des Konflikts, die schon in den ersten Minuten, wenn Ferreira die Folter von Glaubensgenossen mit kochendem Wasser beobachten muss, beantwortet wird. Immerhin schwor er da dem christlichen Glauben ab und beendete die weitere Folter seiner Gläubigen. Später werden dem Konflikt keine neuen Facetten abgewonnen oder die von Ferreira gegebene Antwort in Frage gestellt. Rodrigues beharrt einfach auf seinem Glauben, weil es der wahre Glaube ist.
Diese selbstgewählte Beschränkung führt dazu, dass niemals nach dem Konflikt zwischen verschiedenen Glaubens- und Wertesystemen gefragt wird. Also was unterscheidet den von den Jesuiten gepredigten Glauben vom Buddhismus (zu dem die Christen bekehrt werden sollen) und von der japanischen Weltsicht?
Es wird auch nie angesprochen, warum die japanischen Herrscher die Christen verfolgen, foltern und töten. Es wird auch nicht erklärt, warum die Christen bei ihrem Glauben blieben, wenn sie doch durch ein einfaches Bildertreten ihre Folter sofort hätten beenden können. Dafür hätten sie nur auf einem Bild von Jesus, Maria oder eines Kruzifixes treten müssen. Diese Handlung wurde als Beweis der Abkehr vom christlichen Glauben gewertet.
Ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher verrät, dass es bei der Christenverfolgung um Machtkämpfe ging, dass es um wirtschaftliche Interessen und die Frage des Handels mit dem Westen ging. In den Jahren, in denen „Silence“ spielt, begann Japan eine radikale Abschottungspolitik, die auch zur längsten Friedensperiode in der japanischen Geschichte führte. Die Edo-Epoche dauerte von 1603 bis 1868 und sie verhinderte eine Kolonisierung durch den Westen.
So ist „Silence“ nur ein religiöses Erbauungstraktat, das mit gut drei Stunden Laufzeit auch die Geduld des langmütigsten Zuschauer über Gebühr strapaziert.

Silence (Silence, USA 2016)
Regie: Martin Scorsese
Drehbuch: Jay Cocks, Martin Scorsese
LV: Shusaku Endo: Chinmoku, 1966 (Schweigen)
mit Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Yosuke Kubozuka, Yoshi Oida, Shin’ya Tsukamoto, Issey Ogata, Nana Komatsu, Ryo Kase
Länge: 162 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Der Soundtrack

Es gibt Filmmusik, die schiebt sich wie ein Pickel in den Vordergrund, ist nicht zu überhören und übertönt alles. Sie ist laut, penetrant und störend.
Und dann gibt es Filmmusik wie die von Kim Allen Kluge und seiner Frau Kathryn Kluge zu Martin Scorseses neuem Film „Silence“. Als ich las, dass es einen Soundtrack zu dem Film gibt, fragte ich mich, ob da überhaupt Musik gewesen war. Natürlich war nicht der übliche Martin-Scorsese-Soundtrack aus bekannten Songs zu hören. Es waren auch kein auftriumphierendes Orchester oder mittelalterliche Choralgesänge oder japanische Klänge zu hören.
Und trotzdem gab es Musik. Auf der Soundtrack-CD sind gut 52 Minuten Musik enthalten. Es ist eine filigrane Soundcollage mit vielen Wind-, Regen- und natürlichen Geräuschen, die die traditionelle „Musik“ dominieren. Diese ist sparsam eingefügt, eher percussiv und nah an der Ambient-Musik eines Brian Eno. Damit unterstützt die Musik der Kluges die Stimmung des Films und sie funktioniert auch ausgezeichnet ohne die Bilder als beruhigende Ambient-Musik, in der natürliche Klänge und kleine Änderungen das Klangbild dominieren. Da ist es fast schon konsequent, dass die Musik von Kim Allen und Kathryn Kluge sich nicht für eine Oscar-Nominierung qualifizieren konnte, weil ihre Musik kein „substantial body of music“ sei. Ein gewaltiger Irrtum, auch wenn „Silence“ definitiv nicht zur Hans-Zimmer-Schule der Filmmusik gehört.
Hörenswert!
–
Kim Allen Kluge, Kathryn Kluge: Silence – Original Motion Picture Soundtrack
Warner Classics
–
Die (noch nicht gelesene) Vorlage

Shusaku Endo: Schweigen
(überarbeitete Neuübersetzung, aus dem Japanischen von Ruth Linhart, mit einem Vorwort von Martin Scorsese und einem Nachwort von William Johnson)
Septime Verlag, 2015
312 Seiten
22,90 Euro
–
Originalausgabe
Chinmoku
Verlag Shinchosha, Tokio, 1966
–
Hinweise
Rotten Tomatoes über „Silence“
Wikipedia über „Silence“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Martin Scorseses “Hugo Cabret” (Hugo, USA 2011)
Meine Besprechung von Martin Scorseses “The Wolf of Wall Street” (The Wolf of Wall Street, USA 2013)
Martin Scorsese in der Kriminalakte
–
Ein Gespräch mit Martin Scorsese über „Silence“



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB