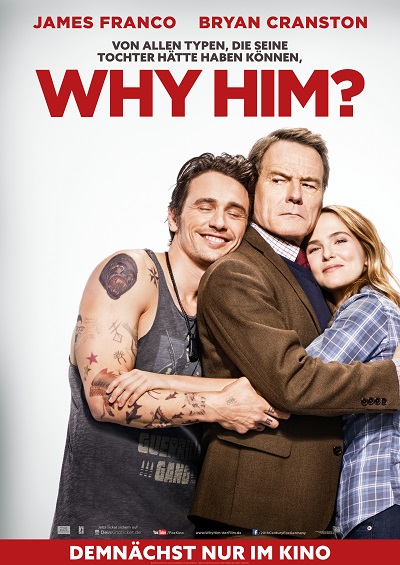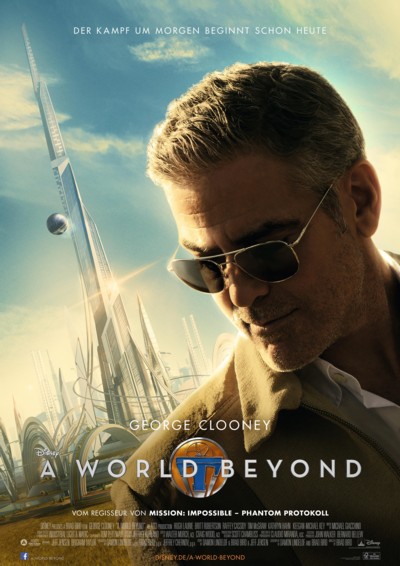Die zwölfjährige Bea muss in New York einige Tage bei ihrer Oma, die sie seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, verbringen. Ihr Vater, ein immer gut gelaunter Spaßmacher, der sich seine kindliche Seite bewahrt hat, liegt dort im Krankenhaus. Der alleinerziehende Witwer wartet auf eine Operation, über die wir nichts genaues erfahren, weil seine Krankheit nicht im Zentrum der Filmgeschichte steht.
Bea wird in ihrem Kinderzimmer einquartiert. Zufällig entdeckt sie, dass in dem Apartment über ihrem Zimmer einige ungewöhnliche und seltsam aussehenden Wesen leben, die nur sie sehen kann. Diese Wesen, wie eine Schmetterlingsdame mit riesigen Augen, verschiedene Teddybären und ein riesiges, unförmiges Plüschwesen, waren früher „Imaginäre Freunde“ von Kindern. Als die Kinder älter wurden, haben sie ihre imaginären Freunde vergessen. Einige IFs leben zusammen mit Cal. Viele weitere IFs leben in einem Altersheim für IFs, das sie lieber gestern als heute verlassen würden. Für diese IFs sucht Cal Kinder, die sie als IFs akzeptieren. Das ist leichter gedacht als verwirklicht. Eine Freundschaft kann nämlich nur entstehen, wenn das Kind ein IF erkennt. Und Kinder können da sehr wählerisch sein.
Bea, die in New York keine Freunde hat, will Cal und den IFs helfen. Als die Suche nach neuen Freunden für die IFs erfolglos verläuft, schlägt sie vor, anstatt neue Freunde zu suchen, einfach wieder die alten Freunde zu besuchen und sie zu fragen, ob sie ihre Freundschaft zu ihrem imaginärem Freund erneuern wollen. Auch das ist leichter gesagt als getan.
Das Konzept eines Imaginären Freundes ist ohne große Erklärungen verständlich und ein Imaginärer Freund kann einem Kind bei seiner Entwicklung helfen. Es scheint sich dabei um eine Idee zu handeln, die in den USA verbreiteter als in Deutschland ist. Jedenfalls zuckten die Eltern, mit denen ich mich in den vergangenen Tagen und Wochen darüber unterhielt, hilflos mit den Schultern. Sie oder ihre Kinder hatten fast alle keine imaginären Freunde. Ob solche imaginären Freunde jetzt etwas gutes oder etwas schlechtes sind, mögen andere beurteilen.
Im Film „IF: Imaginäre Freunde“ sind sie jedenfalls gute, nette, wohlwollende, manchmal tapsige Gesellen und eine Verbindung zur Fantasie der Kindheit. Geschrieben und inszeniert wurde der Film von John Krasinski, der zuletzt Horror- und Science-Fiction-Fans mit seinen beiden „A Quiet Place“-Filmen begeisterte. Jetzt drehte er einen Film, der wohl eine Fantasy-Komödie für Kinder mit Disney-Touch sein soll und bei dem die Schauspieler mit animierten Figuren interagieren. Früher, beispielsweise in „Elliot, das Schmunzelmonster“ oder in „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“, agierten Schauspieler mit Zeichentrickfiguren. Heute agieren sie mit CGI-Figuren, die in diesem Fall auf den ersten Blick als Trickfiguren erkennbar sind. Das ist durchaus gut gemacht.
Aber ein Film besteht nicht nur aus bunten Bildern. Und schon sind wir bei den Problemen von „IF: Imaginäre Freunde“. Für eine Komödie gibt es zu wenig zu lachen. Auch schmunzeln fällt schwer. Es herrscht immer ein forcierter Humor. Er missachtet die Regeln die er aufstellt, nach Belieben. So sollen nur Bea, Cal und der Freund des IFs einen IF sehen können. So sind IFs imaginäre Wesen. Trotzdem gibt es immer wieder Szenen, die gegen diese Regeln verstoßen. Die Story ist während des Sehens nicht erkennbar. Es ist einfach unklar, worum es geht und warum es wichtig ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es ist auch unklar, warum es wichtig ist einen IF zu haben; oder anders gesagt: was tut ein IF für seinen Freund? Die Schlußpointe erklärt dann einiges. Gleichzeitig hat sie ihre eigenen Probleme. Das erkennbare Thema des Films, der Verlust der Kindheit und die Aufforderung sich diese Kindheit zurückzuholen, richtet sich dann nicht an Kinder (die haben ihre IFs ja noch), sondern an Erwachsene; also an die Erwachsenen, die einen IF hatten und jetzt die Gefühle und Freundschaften ihrer Kindheit verdrängt haben.
„IF: Imaginäre Freunde“ ist ein Möchtegern-Disney-Film, dem die Magie und der Charme eines guten Disney-Films fehlt.

IF: Imaginäre Freunde (IF, USA 2024)
Regie: John Krasinski
Drehbuch: John Krasinski
mit Cailey Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski, Fiona Shaw, Liza Colón-Zayas, Alan Kim
(im Original den Stimmen von) Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, John Krasinski, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina, George Clooney, Keegan-Michael Key, Matthew Rhys, Bradley Cooper, Blake Lively, Amy Schumer, Brad Pitt
(in der deutschen Fassung den Stimmen von) Rick Kavanian, Christiane Paul, Lina Larissa Strahl, herrH
Länge: 104 Minuten
FSK: ab 0 Jahre
–
Hinweise
Moviepilot über „IF: Imaginäre Freunde“
Metacritic über „IF: Imaginäre Freunde“
Rotten Tomatoes über „IF: Imaginäre Freunde“
Wikipedia über „IF: Imaginäre Freunde“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von John Krasinskis „A quiet Place“ (A quiet Place, USA 2018)
Meine Besprechung von John Krasinskis „A quiet Place 2“ (A Quiet Place: Part II, USA 2021)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB