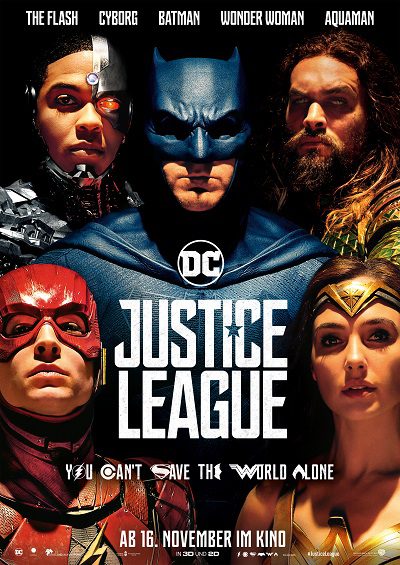„Du kannst die Vergangenheit nicht verändern.“
„Wirklich? Es geht um meine Mutter. Sie darf nicht sterben.“
Zufällig entdeckt „The Flash“ Barry Allen, dessen Superfähigkeit ist, dass er sich wahnsinnig schnell bewegen kann, dass er in der Zeit zurückreisen kann; – wobei hier wohl zurücklaufen das zutreffendere Wort ist. Ihm ist natürlich klar, dass er bei so einer Zeitreise nichts großes verändern darf. Also beispielsweise einen Diktator töten. Aber wenn er eine Kleinigkeit verändert, die dazu führt, dass seine geliebte Mutter nicht ermordet und sein Vater für diese Tat nicht angeklagt wird, dann dürfte das kein Problem sein.
Ist es doch.
Zuerst einmal begegnet er in der Vergangenheit seinem jüngeren Ich, das ein verpeilter, vergnügungssüchtiger Slacker-Student ist. Barry ist dagegen ein überaus ernsthafter, junger Mann, der äußerst intelligent und schüchtern ist. Außerdem hat sein jüngeres Ich noch keine Ahnung von seinen Superheldenfähigkeiten. Er findet sie aber, als er davon erfährt, cool.
Dann gestaltet die geplante Rückreise in die Gegenwart sich als schwieriger als angenommen.
Und dann taucht auch noch General Zod auf. Er ist, wie Fans der DC-Superman-Geschichten und der vorherigen Kinofilme des DC Extended Universe (DCEU) wissen, ein Bösewicht vom Supermans Heimatplaneten Krypton. Er will die Erde vernichten.
Barry will das verhindern. Dafür braucht er die Hilfe seiner aus seiner Welt bekannten Freunde von der Justice League. Sie ist eine Superheldentruppe, zu der unter anderem Batman, Superman, Wonder Woman und Aquaman gehören.
Schon bei „Batman“ Bruce Wayne erlebt er seine erste Überraschung. Dieser Bruce Wayne lebt in einem heruntergekommenen Wayne Manor und er ist ein langhaariger, unrasierter Zausel, der wie Michael Keaton aussieht. Der Batman, den er kennt, sieht aus wie Ben Affleck.
Keaton-Batman erklärt ihm, mit der Hilfe von Spaghetti und Tomatensauce, was Barry mit seiner Zeitreise angerichtet hat. Auch im DC-Multiverse gibt es, wie uns vor einigen Tagen in „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ für das Marvel-Multiverse erklärt wurde, viele verschiedene Zeitstränge, die voneinander unabhängig existieren. Dabei gibt es bestimmte Ereignisse, die in jedem Fall eintreffen. Einige Ereignisse können eintreffen. Und einiges kann ganz ganz anders sein. Aber in jedem Fall beeinflussen diese Zeitstränge sich nicht. Und Zeitreisen gibt es auch nicht. Wenn doch, führt das zu einem ziemlichen Chaos.
Nach dieser Erkärung machen sie sich auf die Suche nach Superman – und zum eine gute Stunde dauerndem Endkampf, der in seiner Ödnis nie die Brillanz der ersten Actionszene des Films erreicht. In dieser Szene überzeugt The Flash als gewitzer und improvisationsfreudiger Babretter. Im Finalkampf wird dann nur noch stumpf gegen General Zod gekämpft, während links und rechts, oben und unten gesichtslose Fußsoldaten sterben.
Nein, die Überraschungen bei „The Flash“ liegen nicht in der Hauptstory, sondern in den zahlreichen Auftritten bekannter Schauspieler und Figuren. Denn mit dem Multiverse gibt es jetzt nicht einen oder zwei, sondern unendlich viele Batmans. Bruce Wayne kann also in einem Film nicht nur aussehen wie Ben Affleck und Michael Keaton, sondern auch, nun, anders. Gleiches gilt auch für alle anderen Figuren. Nur General Zod wird, wie in vorherigen DCEU-Filmen, wieder von einem hoffnungslos unterfordertem Michael Shannon gespielt. Und einige Details wurden zwischen den Welten geändert. Zum Beispiel wie Batmans Haus und Höhle aussehen. Das ist dann etwas für die Fans, die munter eine Liste mit erkannten Anspielungen und Zitaten erstellen.
Andy Muschietti, der vorher die überzeugenden Horrorfilme „Mama“ und „Es“ inszenierte, erfüllt in seinem neuen Film klaglos die Anforderungen, die an einen Superheldenfilm gestellt werden. Das tut er gut, aber auch ohne irgendeine Überraschung. Das Ergebnis ist die Spielfilmversion von Malen nach Zahlen.
Deshalb unterscheiden sich die Kritikpunkte an „The Flash“ nicht von den aus fast allen neueren Superheldenfilmen bekannten Kritikpunkten. Das sind ein vergessenswerter Bösewicht, teils angesichts des Budgets atemberaubend schlechte Tricks und eine schlampig erzählte Geschichte. So dauert es in „The Flash“ ewig, bis General Zod auftaucht. Bis dahin zeigt Andy Muschietti uns, wie sehr Barry seine Mutter liebt, wie er sich in eine ehemalige Mitschülerin, die er jetzt als Journalistin wieder trifft, verliebt, wie er mit seinem jüngeren Ich plaudert und wie er mit Batman kämpft. Das ist unterhaltsam, aber auch immer wieder länger als nötig und so ähnlich inzwischen aus vorherigen Superheldenfilmen bekannt. Mit einer Szene am Ende des Abspanns, kommt „The Flash“ dann auf die inzwischen für Superheldenfilme übliche Laufzeit von ungefähr zweieinhalb Stunden.
Das gesagt steht „The Flash“ vor allem als Einzelfilm, der seit Jahren angekündigt und in der Planung war. Er kann auch ohne das Wissen des DCEU gesehen werden. Wobei etwas Wissen über die Figuren hilfreich ist. Aber alles für diesen Film wichtige erklärt Barry seinem jüngeren Ich.
„The Flash“ könnte der erste und letzte Solofilm mit Ezra Miller als The Flash sein. Das liegt einerseits an seinem Verhalten in der Öffentlichkeit und damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten. Inzwischen hat er gesagt, er habe psychische Probleme gehabt und befinde sich in Behandlung. Andererseits richten James Gunn und Peter Safran, die aktuell die Verantwortung für das DCEU haben, dieses komplett neu aus. Es ist dabei unklar, welchen Stellenwert Ezra Miller und The Flash im Rahmen dieser Neuausrichtung haben werden.

The Flash (The Flash, USA 2023)
Regie: Andy Muschietti
Drehbuch: Christina Hodson (nach einer Filmgeschichte von John Francis Daley, Jonathan Goldstein und Joby Harold, basierend auf DC-Figuren)
mit Ezra Miller, Sasha Calle, Ben Affleck, Michael Keaton, Michael Shannon, Ron Livingston, Antje Traue, Jeremy Irons, Temuera Morrison, Kiersey Clemons, Maribel Verdú
Länge: 144 Minuten
FSK: ab 12 Jahre
–
Hinweise
Rotten Tomatoes über „The Flash“
Wikipedia über „The Flash“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Andy Muschiettis „Mama“ (Mama, Spanien/Kanada 2012)
Meine Besprechung von Andy Muschiettis Stephen-King-Verfilmung „Es“ (It, USA 2017)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB