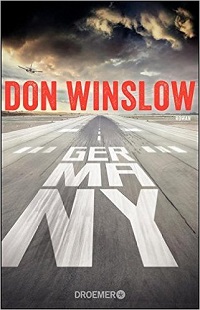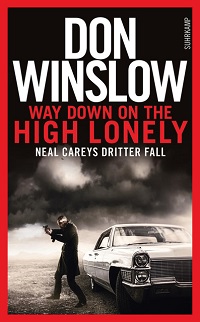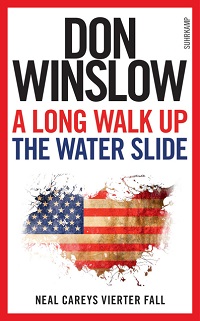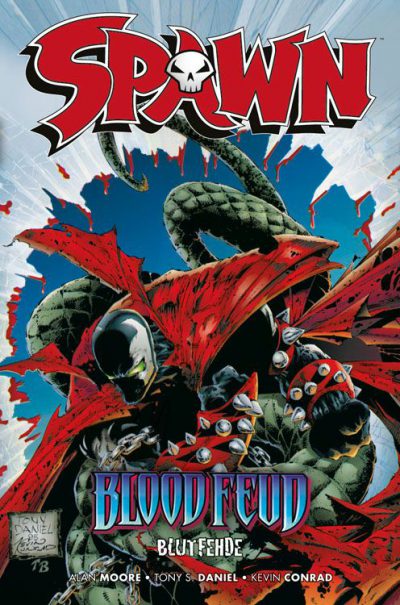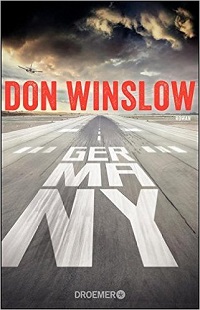
„Eine Katastrophe von Krimi“ und „’Germany‘ ist kein schlechtes Buch. Es ist ein scheußliches Buch“ sagt Christian Buß in seiner Spiegel-Kritik über Don Winslows neuen Roman „Germany“. Thomas Wörtche sieht es ähnlich – und bei mir schlägt dann, schon bevor ich eine Zeile gelesen habe, der „So schlecht kann es doch nicht sein“-Effekt zu. Und so schlecht ist „Germany“ dann auch nicht. Die harschen Kritiken klingen eher nach dem Gejammer eines enttäuschten Liebhabers, der jetzt bei seiner früheren Liebe nur noch das Negative sieht.
2009 begann der Suhrkamp-Verlag die Romane von Don Winslow auf Deutsch zu veröffentlichen. Einige seiner Romane waren bei anderen Verlagen schon in den Neunzigern erschienen und nicht mehr erhältlich. In den USA war er in den zehn Jahren zu einem Liebling der Krimiszene geworden. Die Kritiken zu den bei Suhrkamp veröffentlichten Romanen waren überschwänglich euphorisch. Er wurde, vor allem mit „Tage der Toten“ (The Power of the Dog) über den Drogenkrieg in Südamerika, zum Krimigott hochgejazzt. Mit „Vergeltung“, „Missing. New York“ und „Germany“ schrieb er jetzt mehrere in den USA noch nicht veröffentlichte Romane, in denen die moralischen Ambivalenzen seiner früheren Romane, vor allem natürlich seiner in Kalifornien im Surfer- und Drogenhändlermilieu spielenden Romane, fehlen. Dabei reflektieren seine Romane auch immer den Zeitgeist und das Milieu in dem sie spielen in all seinen Facetten.
Das zeigt sich besonders deutlich an seinen in mehreren Romanen auftretenden Privatdetektiven.
Neal Carey war der erste. Er trat in fünf Romanen auf, die gleichzeitig seine ersten veröffentlichten Romane waren. Er schrieb sie in den Neunzigern, aber sie spielen in den Siebzigern und frühen achtziger Jahren.
Boone Daniels war der zweite. Er trat 2008 und 2009 in „Pacific Private“ (The Dawn Patrol) und „Pacific Paradise“ (The Gentlemen’s Hour) auf und das Besondere an diesen Romanen ist, dass der Detektiv ein passionierter Surfer ist und seine Fälle untrennbar mit diesem Milieu verbunden sind.
Mit Frank Decker hat er jetzt, wie es sich für einen Privatdetektivroman gehört, geschrieben in der ersten Person Singular, einen neuen Privatdetektiv in den Startlöchern, der, wie seine beiden vorherigen Privatdetektive (was sie auch ohne Lizenz sind), ein Kind seiner Zeit ist. Decker ist Ex-Soldat, Ex-Polizist, geschieden und, wenn auch kein Donald-Trump-Wähler, sicher ein Republikaner, der den alten Western-Idealen nachhängt und keine Probleme hat, Waffen einzusetzen und zu töten. Entsprechend einfach ist seine und die in Romanen protegierte Weltsicht: auf der einen Seite sind die Guten. Frank Decker und die von ihm gesuchte vermisste Person. Auf der anderen Seite die Bösen, die ziemlich Böse sind. In „Germany“, seinem zweiten Fall nach „Missing. New York“, verschwindet in Florida Kim Sprague spurlos. Sie ist die junge, gutaussehende Frau von seinem Army-Kameraden und Lebensretter Charlie. Die Spur führt in Richtung Organisierte Kriminalität, Zwangsprostitution und Menschenhandel. Alles Dinge, die die Verbrecher, vor allem wenn sie aus Russland kommen, zu Kandidaten für die Todesstrafe machen.
Das ist natürlich flott, aber auch arg humorlos geschrieben und wenn Frank Decker ab Seite 267 in Deutschland nach Kim sucht, wird der Thriller zu einer für uns Ortskundigen langweiligeren Angelegenheit. Denn Decker besucht auf seiner Suche quer durch Deutschland ungefähr ein halbes Dutzend Städte als lägen sie nebeneinander und als ob die Bösen nur auf ihn warteten.
Als Dank an seine deutschen Leser und als Verarbeitung von Reiseerlebnissen (immerhin führten mehrere Lesereisen Don Winslow quer durch Deutschland) ist dieser Teil zwar als Fanservice nachvollziehbar, aber die Orte bleiben austauschbar.
Aus dramaturgischer Sicht ist der Schauplatzwechsel für etwas über hundert Seiten vollkommen unnötig. Letztendlich wäre es besser gewesen, die ganze Geschichte an einem Schauplatz, also Florida, spielen zu lassen. Auch wegen der Lösung, die gar nicht so weit weg von den guten alten Hardboiled-Krimis ist.
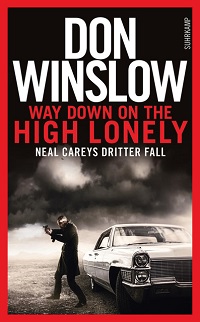
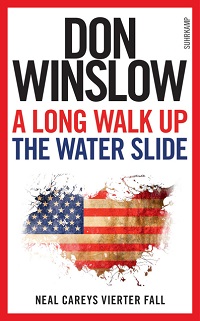
Das Gegenmodell zu Frank Decker ist Neal Carey, der erste Seriencharakter von Don Winslow, dessen Fälle jetzt teilweise erstmals auf Deutsch erscheinen. Immer in neuen Übersetzungen von Conny Lösch, der Stammübersetzerin von Don Winslow. Jüngst erschienen bei Suhrkamp „Way down the High Lonely“, der dritte Carey-Roman in einer neuen Übersetzung, und „A long Walk up the Water Slide“, der vierte Carey-Roman, auf Deutsch.
Neal Carey ist ein New Yorker Junge, der von Joe Graham, seinem „Daddy“, der als Detektiv für die Freunde der Familie, einer besonderen Abteilung einer noblen Privatbank, arbeitet, groß gezogen wird. Graham lehrt ihn alles, was man zum Leben braucht von englischer Literatur über das Putzen der Wohnung und dem unauffälligen Observieren bis hin zum gepflegten Einbruch. Auch Neal soll für die Freunde der Familie, die ihm seine Ausbildung bezahlen, arbeiten. Was vor allem bedeutet, dass er die sprichwörtlichen Kastanien aus dem Feuer holen soll. Dabei würde er viel lieber sein Universitätsstudium mit einer Arbeit über den Literaten Tobias Smollett abschließen.
Am Ende von „China Girl“ wurde er in China in ein sehr abgelegenes buddhistisches Kloster verbannt.
Drei Jahre später, am Anfang von „Way down the High Lonely“, ist Ronald Reagan Präsident der USA. Joe holt ihn aus seinem Gefängnis. Die Freunde der Familie brauchen ihn. Er soll Cody McCall, den zweijährigen Sohn einer Hollywood-Produzentin, finden. Cody wurde von seinem Vater Harley McCall entführt. Er ist ein waschechter Cowboy, den die Produzentin während den Dreharbeiten für einen Western kennen und lieben lernte und später, in Hollywood, bemerkte, dass er nicht in ihre Welt passt. Die Ehe ging in die Brüche. Er wurde zum cholerischen Trinker und verschwand vor drei Monaten spurlos mit Cody.
Neal übernimmt den Fall. Seine Ermittlungen führen ihn nach Nevada in ein menschenleeres Gebiet, das als The High Lonely bekannt ist. Dort vermutet er Harley als Mitglied einer Gruppe von Rassisten, die die jüdische Machtübernahme befürchten und sich für den Endkampf rüsten. Neal versucht sich in die Gruppe einzuschleichen.
In „A long Walk up the Water Slide“ soll Neal Carey das Englisch von Dolly Paget aufbessern. Die Wuchtbrumme behauptet nämlich, von dem beliebten TV-Präsentator einer Familiensendung und Inhaber des TV-Senders Family Cable Network Jack Landis vergewaltigt worden zu sein. Dabei war sie vorher seine außereheliche Affäre und, was Neal erst später erfährt, sie ist schwanger.
Während Neal sie noch in die Feinheiten der englischen Sprache einführt, haben mehrere Parteien, unter anderem ein geheimnisvoller Profikiller, die Mafia und ein Herausgeber von Sexheften, ein großes Interesse an der Dame, die sie, wahlweise, ausziehen oder töten wollen.
Nachdem schon die vorherigen Neal-Carey-Romane dank des trockenen Humors eine witzig-kurzweilige Lektüre waren, ist der für den Dily Award nominierte „A long Walk up the Water Slide“ eine waschechte Krimikomödie, in der alle Pläne regelmäßig schief gehen, Irrtümer und Missverständnisse für ungeahnte Konflikte sorgen und Neal, nach einem nächtlichen Überfall auf sein Haus, Dolly, Jack Landis‘ Frau Candy und seine Freundin Karen in Las Vegas in einem Hotel versteckt, in dem gerade die Jahreskonferenz des Erotikfilm-Verbandes ist; was für weitere Verwicklungen sorgt.
Don Winslow schrieb seine fünf Neal-Carey-Romane zwar in den Neunzigern, aber weil sie in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern spielen, atmen sie genau diesen Zeitgeist ein. Es ist der Zeitgeist der sexuellen Revolution, der cleveren Außenseiter-Helden, die die Fälle nicht mit Gewalt, sondern mit Grips (und ihrem Mundwerk) lösen und der großen Sympathie für schräge, oft moralisch zwiespältige Charaktere, verschiedener Lebensentwürfe und einer insgesamt liberalen, offenen Haltung.
Es ist auch die Zeit, in der TV-Serien wie „Detektiv Rockford – Anruf genügt“, „Magnum“, „Simon & Simon“, „Das Model und der Schnüffler“ und „Remington Steele“ mit ihren sprücheklopfenden Helden äußerst beliebt waren und Robert B. Parker mit seinen „Spenser“-Romanen das Genre fast im Alleingang revolutionierte. Don Winslows Neal Carey, der edle Ritter im Auftrag einer Bank (und einem von Hassliebe zu seinem Geldgeber geprägtem Verhältnis) steht in dieser Tradition.
Das ist großartige Krimi-Unterhaltung mit einem realistischen Unterton, die ziemlich direkt zu seinen in Kalifornien spielenden, weniger witzigen, lakonisch erzählen Krimis führt, in denen Verbrecher die durchaus sympathischen Helden wurden. Immerhin folgten sie einem Kodex und die mexikanischen Drogenkartelle und korrupte Polizisten sind viel schlimmer.
Der fünfte Carey-Roman „Palm Desert“ soll Mitte Juni erscheinen.
–
Don Winslow: Way Down on the High Lonely – Neal Careys dritter Fall
(übersetzt von Conny Lösch)
Suhrkamp, 2016
352 Seiten
11,99 Euro
–
Deutsche Erstausgabe
Das Schlangenmaul
(übersetzt von Ulrich Anders)
Piper, 1998
–
Originalausgabe
Way Down on the High Lonely
St. Martin’s Press, 1993
–
Don Winslow: A long Walk up the Water Slide – Neal Careys vierter Fall
(übersetzt von Conny Lösch)
Suhrkamp, 2016
304 Seiten
11,99 Euro
–
Originalausgabe
A long Walk up the Water Slide
St. Martin’s Press, 1994
–
Don Winslow: Germany
(übersetzt von Conny Lösch)
Droemer, 2016
384 Seiten
14,99 Euro
–
Originalausgabe
Germany
2016 (noch nicht in den USA veröffentlicht)
–
Hinweise
Hollywood & Fine: Interview mit Don Winslow (11. Juli 2012)
Homepage von Don Winslow (etwas veraltet, weil eigentlich eine Verlagsseite)
Deutsche Homepage von Don Winslow (von Suhrkamp)
Don Winslow twittert ziemlich oft
Meine Besprechung von Don Winslows “London Undercover” (A cool Breeze on the Underground, 1991)
Meine Besprechung von Don Winslows “China Girl” (The Trail to Buddha’s Mirror, 1992)
Meine Besprechung von Don Winslows „Bobby Z“ (The Death and Life of Bobby Z, 1997)
Meine Besprechung von Don Winslows „Tage der Toten“ (The Power of the Dog, 2005)
Meine Besprechung von Don Winslows „Pacific Private“ (The Dawn Patrol, 2008)
Meine Besprechung von Don Winslows „Pacific Paradises“ (The Gentlemen’s Hour, 2009) und „Tage der Toten“ (The Power of the Dog, 2005)
Meine Besprechung von Don Winslows „Satori“ (Satori, 2011)
Mein Interview mit Don Winslow zu “Satori” (Satori, 2011)
Meine Besprechung von Don Winslows “Savages – Zeit des Zorns” (Savages, 2010)
Meine Besprechung von Don Winslows “Kings of Cool” (The Kings of Cool, 2012)
Meine Besprechung von Don Winslows „Vergeltung“ (Vengeance, noch nicht erschienen)
Meine Besprechung von Don Winslows “Missing. New York” (Missing. New York, noch nicht erschienen)
Meine Besprechung von Don Winslows „Das Kartell“ (The Cartel, 2015)
Mein Hinweis auf Don Winslows „London Undercover – Neal Careys erster Fall“ (A Cool Breeze on the Underground, 1991)
Meine Besprechung von Oliver Stones Don-Winslow-Verfilmung „Savages“ (Savages, USA 2012)
Don Winslow in der Kriminalakte
Gefällt mir Wird geladen …



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB