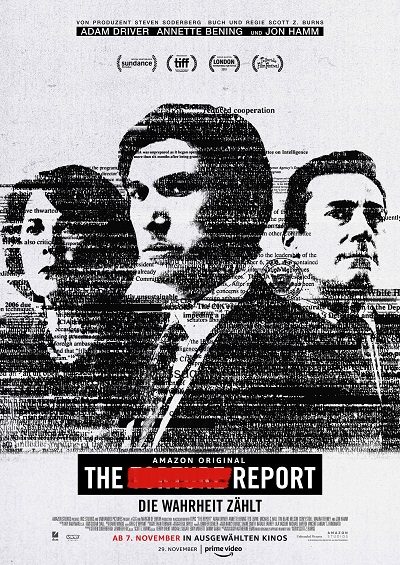Einerseits hat „Last Christmas“ mit Paul Feig als Regisseur und Emma Thompson, zusammen mit Bryony Kimmings, als Drehbuchautorin zwei vertrauenswürdige Macher hinter der Kamera. Feig inszenierte „Brautalarm“, „Taffe Mädels“, „Spy – Susan Cooper undercover“, „Ghostbusters“ und „Nur ein kleiner Gefallen“. Thompson ist vor allem als Schauspielerin bekannt. Ihre Karriere begann sie als Komödiantin. Sie hatte eine kurzlebige TV-Comedy-Show, die als „männerfeindlich“ verrissen wurde. Sie schrieb seitdem auch ein, zwei Drehbücher, wie „Sinn und Sinnlichkeit“ (wofür sie den Drehbuchoscar erhielt) und „Eine zauberhafte Nanny“. Sie ist auch bekannt für ihren galligen Witz und Sarkasmus.
Andererseits ist „Last Christmas“ ein Weihnachtsfilm, der schon auf dem Plakat all das hat, was Weihnachtsfilme so an Schrecknissen zu bieten haben. Außerdem wurden für den Film mehrere Songs von George Michael benutzt, unter anderem das titelgebende „Last Christmas“ und ein bislang unveröffentlichter Song. Weil ich definitv nicht zu den George-Michael-Fans gehöre und Weihnachtsfilme grundsätzlich vermeide, sind das für mich zwei überhaupt nicht frohe Botschaften.
Auch die Geschichte ist auf den ersten Blick die typische kitschige Weihnachtsfilmgeschichte: Kate (Emilia Clarke) ist ein durch London wandelndes Katastrophengebiet. Sie arbeitet, verkleidet als Weihnachtself, in einem Weihnachtsgeschenkeladen. Den Kunden gegenüber ist sie unhöflich und ihre Karriere als Sängerin ist nicht existent. Weil sie im Moment keine Wohnung hat und nicht wieder bei ihren Eltern einziehen will, schläft sie bei Freundinnen.
Eines Tages trifft sie den sehr gutaussehenden, sehr charmanten und etwas geheimnisvollen Tom (Henry Golding), der alles das verkörpert, was eine Frau sich von einem Mann wünschen kann.
Aber Thompson und Feig streuen in diese kurz vor Weihnachten spielende RomCom immer wieder genug Salz um sie nicht zu einem dieser typischen zuckerigen, wirklichkeitsfernen Kitschfeste ausarten zu lassen.
Bis zum Ende verlässt diese vorhersehbare Geschichte deshalb immer wieder die Pfade des ausgetretenen Weihnachtskitsches. Sie setzt einige interessante Akzente, für die vor allem die Frauen zuständig sind. Kate ist eine respektlose und sehr sarkastische Person. Ihre Mutter Petra, gespielt von Emma Thompson mit Freude an den hausmütterlichsten Kleidern, die es wahrscheinlich in ganz England gibt, und einem überbesorgten Muttertrieb, und Kates Chefin Santa, gespielt von Michelle Yeoh als humorlos, diktatorische Chefin, die dann doch eine menschliche Ader hat, sind ebenso sarkastisch. Sie können auch mit dem ganzen Weihnachtskitsch wenig anfangen.
Die Männer sind in „Last Christmas“ nur noch eindimensionale Nebenfiguren, die vor allem den eben genannten Frauen ihre Wünsche erfüllen und ansonsten still sein sollen. Diese Umkehr der aus alten Unterhaltungsfilmen bekannten Geschlechterklischees ist eine nicht besonders subtile Kritik daran.
Tom hat als Kates Liebhaber und geistiger Führer durch das nächtliche London noch am meisten Eigenleben. Aber vor allem umgarnt er sie, ist nett,, höflich und sehr respektvoll. So weicht er auf dem Bürgersteig elegant allen Menschen aus.
Der Däne ist so verliebt in Santa, dass er sie sprachlos anhimmelt und tagelang auf der Straße vor dem Weihnachtsgeschäft stehen würde, wenn Kate ihn nicht in das Geschäft zu Santa gezerrt hätte. Im gesamten Film hat er ungefähr zwei Sätze.
Und Kates Vater hört seiner Frau und seinen Töchtern zugequatscht geduldig zu und gibt ihnen recht. Wenn er mal etwas sagen darf.
Erzählt wird Kates Weihnachtsgeschichte angenehm respektlos vor den Konventionen des Weihnachtsfilm, die dann letztendlich doch befolgt werden. Der Ton ist oft überraschend sarkastisch und schwarzhumorig, mit einigen herrlichen Spitzen und einem Blick auf aktuelle englische Probleme zwischen Obdachlosigkeit, Emigration und, in einem Halbsatz, Brexit.
All das macht aus „Last Christmas“ sicher keinen künftigen Klassiker. Dafür ist die Hauptgeschichte dann doch zu nachlässig entwickelt, während einzelnen Episoden und Gags in den Subplots zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es ist auch ein Film, der etwas zu sehr von seinen verschiedenen Verneinungen lebt. So will er kein kitschiger Weihnachtsfilm sein, aber auch nicht das Gegenteil. Er ist auch ein Film, der schon seinen Titel von George Michaels ewigem Weihnachtshit „Last Christmas“ hat, seine Geschichte von einer Zeile aus dem Song inspirieren lässt und der während des Films mehrere George-Michael-Songs erklingen lässt. Aber sie bleiben weitgehend austauschbare Lieder, die im Hintergrund zu hören sind.
Für die Fans kitschiger Weihnachtsfilme, die jedes Jahr in unzähligen Kinos und TV-Programmen laufen, ist das dann sicher etwas unbefriedigend. Für alle anderen ist Feigs Komödie eine durchaus vergnügliche Angelegenheit. Auch dank der Damen Clarke, Thompson und Yeoh.

Last Christmas (Last Christmas, Großbritannien 2019)
Regie: Paul Feig
Drehbuch: Emma Thompson, Bryony Kimmings (nach einer Geschichte von Emma Thompson und Greg Wise)
mit Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, Lydia Leonard, Rita Aryam, Liran Nathan, Calvin Demba, Peter Mygind, Boris Isakovic
Länge: 103 Minuten
FSK: ab 0 Jahre
–
Hinweise
Deutsche Facebook-Seite zum Film
Moviepilot über „Last Christmas“
Metacritic über „Last Christmas“
Rotten Tomatoes über „Last Christmas“
Wikipedia über „Last Christmas“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Paul Feigs „Taffe Mädels“ (The Heat, USA 2013)
Meine Besprechung von Paul Feigs „Spy – Susan Cooper Undercover“ (Spy, USA 2015)
Meine Besprechung von Paul Feigs „Ghostbusters“ (Ghostbuster, USA 2016)
Meine Besprechung von Paul Feigs „Nur ein kleiner Gefallen“ (A simple Favor, USA 2018) und der DVD



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB