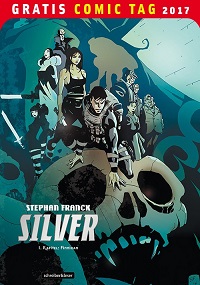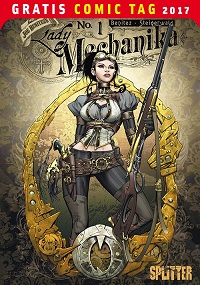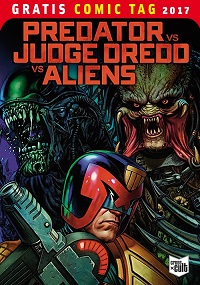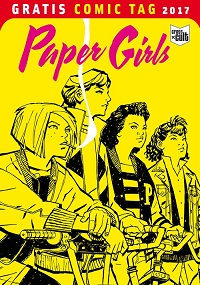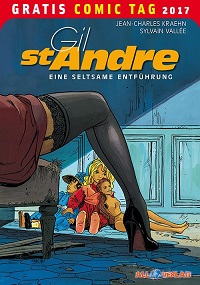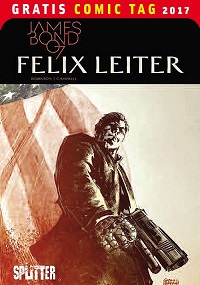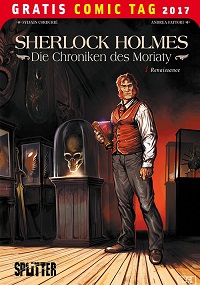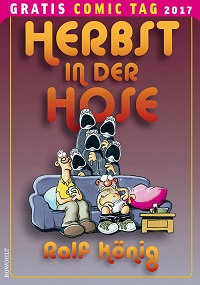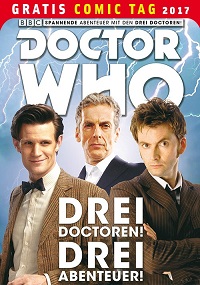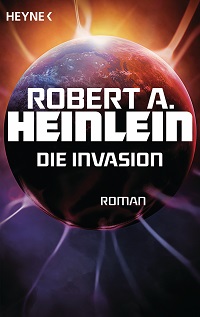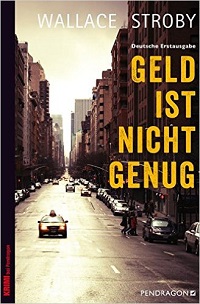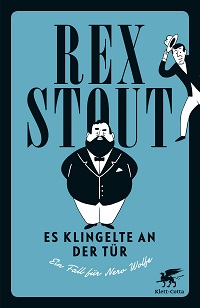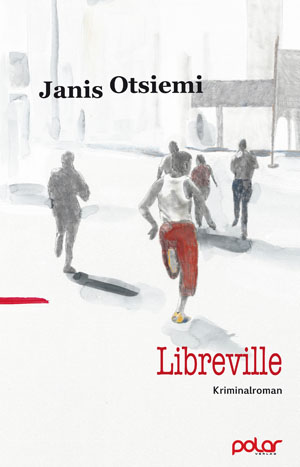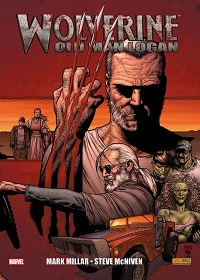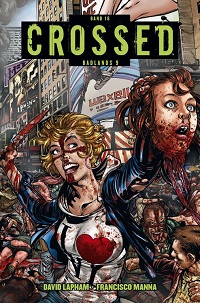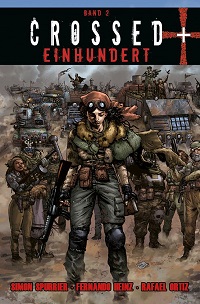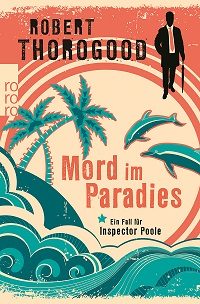In London fragt ein Mann per Anruf in einer Boulevardzeitung, wie viele Polizisten er ermorden soll. Das könnte ein geschmackloser Scherz sein, wenn er nicht schon einmal zugeschlagen hätte und dieser Mord der Auftakt einer Serie von insgesamt acht Polizistenmorden sein soll.
Detective Sergeant Brant und seine Kollegen von der South East London Police Squad machen sich auf die Jagd nach dem Polizistenmörder.
„Brant“ ist der bekannteste Brant-Roman von Ken Bruen. Denn er wurde 2011 von Elliott Lester mit Jason Statham verfilmt. Für einen Kinostart von „Blitz“ in Deutschland reichte es dann doch nicht – düstere Cop-Dramen laufen bei uns halt nicht im Kino -, aber auf DVD erschien der Film, er ist gut erhältlich und läuft auch ziemlich regelmäßig im TV.
Der Roman ist der vierte von sieben Brant-Romanen, die Ken Bruen zwischen 1998 und 2007 schrieb und die seit letztem Jahr in nicht chronologischer Reihenfolge bei polar erscheinen. Das mindert etwas das Lesevergnügen, denn die Charaktere und ihre Beziehungen entwickeln sich von Roman zu Roman weiter und Bruen spielt immer wieder auf Ereignisse aus den vorherigen Romanen an, während er die Handlung immer weiter verknappt. Das gilt für die Haupt- und Nebenhandlungen. Immerhin sind die Brant-Romane Polizeikriminalromane, die sich auf der formalen Ebene an Ed McBains langlebigen, das Genre prägenden Serie über das 87. Polizeirevier orientieren. Bruen unterläuft allerdings die Konventionen des Polizeiromans mit viel Schwarzem Humor, literarischen Anspielungen und einer invertierten Moral. Bei Bruen gibt keine guten Bobbys, sondern nur verschieden schlechte Cops, die alle mehr oder weniger die Arbeit erledigt bekommen. Unter fröhlicher Missachtung der Dienstvorschrift und jedes zivilisierten Verhaltenskodex. Der schlimmste von ihnen ist Brant und in „Brant“ legt er auf den ersten Seiten auch gleich mächtig los. Beim Polizeipsychiater raucht er (entgegen der Verbotsschilder), verpasst ihm eine Kopfnuss, zwingt ihn zum Glenfiddich-Trinken und schwärzt ihn bei den internen Ermittlern als Trinker an. Das geschieht alles auf den ersten fünf Seiten des Romans und, wie auch auf den ersten Seiten seines ersten Jack-Taylor-Privatdetektivromans „Jack Taylor fliegt raus“ (The Guards) (auch verfilmt), weiß man nach diesem Auftakt, ob man für das Buch geeignet ist oder doch lieber einen lauschigen Häkelstrickkrimi mit honorigen Polizisten und Mördern liest.
–
Ken Bruen: Brant
(übersetzt von Len Wanner)
polar Verlag, 2017
256 Seiten
16 Euro
–
Originalausgabe
Blitz – or… Brant hits the Blues
Do Not Press, 2002
–
Verfilmung
Blitz – Cop-Killer vs. Killer-Cop (Blitz, Großbritannien 2011)
Regie: Elliott Lester
Drehbuch: Nathan Parker
mit Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, Zawe Ashton, David Morrissey, Ned Dennehy, Mark Rylance, Luke Evans
–
Hinweise
Meine Besprechung von Ken Bruens „Füchsin“ (Vixen, 2003)
Meine Besprechung von Ken Bruens „Kaliber“ (Calibre, 2006)
Meine Besprechung von Ken Bruens Jack-Taylor-Privatdetektivromanen
Meine Besprechung von Ken Bruens „Jack Taylor fliegt raus“ (The Guards, 2001)
Meine Besprechung von Ken Bruens “Jack Taylor liegt falsch” (The Killing of the Tinkers, 2002)
Meine Besprechung von Ken Bruens „Sanctuary“ (2008)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Jason Starrs „Flop“ (Bust, 2006)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Jason Starrs „Crack“ (Slide, 2007)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Jason Starrs „Attica“ (The MAX, 2008)
Meine Besprechung von Ken Bruen/Reed Farrel Colemans “Tower” (Tower, 2009)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB