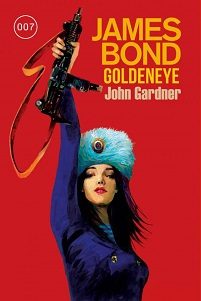Eddington ist ein Kaff in New Mexico. Im Frühjahr 2020 kandidiert Ted Garcia (Pedro Pascal) wieder als Bürgermeister. Er will in der menschenleeren Gegend ein Rechenzentrums für künstliche Intelligenz ansiedeln. Dieses Jahr hat er einen Spontan-Gegenkandidaten: den Ortssheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix). Der Wahlkampf, der in dem 2345-Seelen-Dorf aufgezogen wird, kopiert schamlos und sinnfrei die aus Metropolen bekannten Bilder und Methoden. Gleichzeitig eskaliert er vor der damaligen Corona-Politik, die zum Tragen von Masken und dem Halten von bestimmten Abständen zwingt. Das entbehrt in einer menschenleeren Stadt nicht einer gewissen Komik. Dazu kommen Meldungen über den Tod von George Floyd und die Reaktionen darauf. Schließlich wird auch in Eddington von Jugendlichen gegen Polizeigewalt demonstriert. Und schon ist Eddington das Zentrum der Welt, in dem Paranoia und Verschwörungstheorien, vor allem Online-Verschwörungstheorien, aufeinandertreffen und sinnfrei nachgestellt werden.
Mittels vieler auf Handys gezeigter Nachrichtenschnipsel und verschwörungstheoretischer Statements eröffnet Aster einen weiteren Zugang zur großen Politik.
„Eddington“ könnte der Film zur Stunde sein. Es könnte der Film sein, der die US-amerikanische Gesellschaft schonungslos seziert, ihr den satirischen Spiegel vorhält und dabei gleichermaßen nach allen Seiten austeilt.
Aster scheint dagegen, jedenfalls legen das seine Statements im Presseheft nahe, eher so in Richtung filmisches Äquivalent zum ‚großen amerikanischen Roman‘ gedacht zu haben.
„Eddington“ soll soll ein Gesellschaftsporträt sein, „ohne jemandem explizit den schwarzen Peter zuzuschieben“. Aster will „eine Art amerikanisches Genre-Epos mit aktualisierten Archetypen erschaffen“, das „für alle diese Charaktere Sympathie aufbringt“.
Das klingt nach einer todsterbenslangweiligen Soziologie-Stunde, in der der Professor liebevoll die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen aufschlüsselt. Danach kann man schlauer sein, aber ein guter Spielfilm entsteht so nicht.
Aster hat auch eine These zur aktuellen US-amerikanischen Gesellschaft. Danach ist die ursprüngliche Idee der Demokratie verschwunden. Die Menschen werden immer machtloser, Big-Tech-Konzerne immer mächtiger. Diese Konzerne erfinden Strohmänner und imaginäre Feinde. Sie lenken von den wahren Problemen und Machtstrukturen ab. Stattdessen hetzen sie die Menschen aufeinander.
Diese These, siehe den vor einigen Tagen gestarteten SF-Actionfilm „The Running Man“ und ungefähr jede Dystopie, kann eine gute Grundlage für einen guten Film sein. „Eddington“ ist nicht dieser Film. Statt einer scharfen und zugespitzen Analyse der Gesellschaft gibt es eine Satire mit unscharfen Cartoon-Figuren und einer politischen Analyse, die noch nicht einmal das Niveau eines Tweets erreicht. Plakativ wird einfach ausgestellt, was gerade auf dem Smartphone in den Schlagzeilen aufpoppte.
„Eddington“ ist eine zähe, ausufernde und ausfransende Möchtegernsatire, die mit 150 Minuten mindestens dreißig bis fünfzig Minuten zu lang ist. Es ist ein Wust absurder, abstruser und vollkommen belangloser, meist viel zu lang geradener Episoden, in denen nervig-unsympathische Dummköpfe sich und uns nerven. Dazwischen schneidet Aster Nachrichtenschnipsel und Bespaßungen von Verschwörungstheoretikern aus dem Internet und er lässt Sheriff Cross in seinem Polizeiwagen in Echtzeit im Schritttempo durch das Dorf fahren.

Eddington (Eddington, USA 2025)
Regie: Ari Aster
Drehbuch: Ari Aster
mit Joaquin Phoenix, Deirdre O’Connell, Emma Stone, Micheal Ward, Pedro Pascal, Cameron Mann, Matt Gomez Hidaka, Luke Grimes, Austin Butler
Länge: 150 Minuten
FSK: ab 16 Jahre
–
Hinweise
Rotten Tomatoes über „Eddington“
Wikipedia über „Eddington“ (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Ari Asters „Hereditary – Das Vermächtnis“ (Hereditary, USA 2018)
Meine Besprechung von Ari Asters „Midsommar“ (Midsommar, USA 2019)
Meine Besprechung von Ari Asters „Beau is afraid“ (Beau is afraid, USA 2023)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB