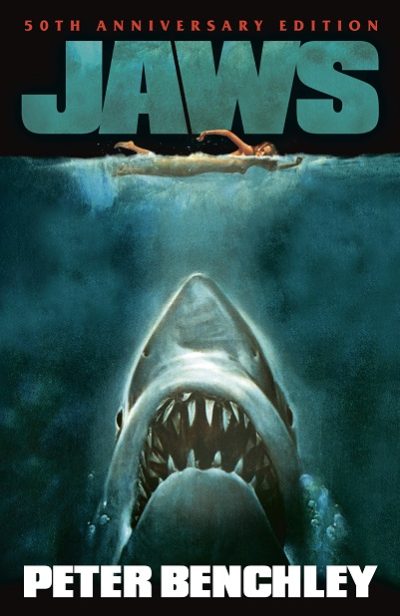Dass Superhelden nicht immer die freundlichen Helfer aus der Nachbarschaft sind, konnte man sich schon bei einigen normalen Superheldencomics denken. Wenn der Held bei seiner Verbrecherjagd mal wieder eine halbe Stadt zerstört und dabei, außerhalb der Bilder, auch etliche Einwohner tötet, kommt das bei den Betroffenen und ihren Freunden und Bekannten nicht gut an. Und das mit großer Macht große Verantwortung komme, stimmt zwar, aber es heißt nicht, dass Menschen mit großer Macht auch verantwortungsvoll mit dieser Macht umgehen. Wahrscheinlich eher nicht.
Jedenfalls ging Garth Ennis von dieser Idee aus, als er 2006 zusammen mit Zeichner Darik Robertson seine erfolgreiche Superheldenserie „The Boys“ startete. In der Comicserie sind Superhelden eine Bande präpotenter Teenager, die bei ihren unverantwortlichen, nicht durchdachten und normalerweise aus dem Ruder laufenden Aktionen nur Unheil anrichten. Ihre Fähigkeiten erhielten sie von dem Konzern Vought-American, der seit Ewigkeiten für das US-Militär arbeitet und ihm ihre Fehlschläge als Erfolge verkaufte. Seit längerem sorgen lukrative Werbeverträge für Einnahmen und ein positives Image in der Öffentlichkeit.
Gegen diese Superhelden kämpfen, im Auftrag der CIA, Billy Butcher und sein grenzwertiges Team „The Boys“. Sie verstehen ihre Aufgabe als Freischein, ab und an Superhelden zu verprügeln.
Ende 2012 endetete die von Ennis und Robertson erfundene Comicserie mit dem 72. Heft. In dem jetzt erschienenen sechsten Sammelband sind die Hefte 60 bis 72 enthalten.
Die ersten Seiten versprechen dann auch einen zünftigen, sich über den gesamten Sammelband von über dreihundert Seiten erstreckenden Showdown. Nachdem vorher immer wieder unklar war, wohn sich die Geschichte entwickeln könnte, stellen sich jetzt Homelander und seine Superhelden gegen die US-Regierung. Sie besetzten das Weiße Haus.
In dem Moment erhält Billy Butcher die Erlaubnis, die Supies zu eliminieren. Er kann also endlich tun, was er schon seit Ewigkeiten tun möchte. Er darf dabei auch nach eigenem Ermessen Gewalt anwenden. Es wird sehr blutig und, wie der Titel des Sammelbandes verrät, emotional. Denn „Vergeltung hat ihren Preis“.
Dieses Ende der Boys wirkt eher pflichtschuldig als inspiriert. Lose Fäden werden zusammengefügt, aber so richtig überzeugend oder überraschend ist nichts. Auch die Idee, dass die Superhelden ein Produkt der Zusammenarbeit von Privatwirtschaft und Militär, dem Militärisch-Industriellen-Komplex (MIK), sind, ist hier mehr eine für etwas Amüsement sorgende Idee als eine Negativutopie oder eine Zustandsbeschreibung der damaligen US-Außenpoltiik nach 9/11.
Im Gegensatz zu Brian Azzarello und Eduardo Risso, die ab 1999 in „100 Bullets“, oder zu James Ellroy, der ab 1996 in seiner „Underworld USA“-Trilogie (und seinen anderen Romanen), eine alternative Geschichte der USA schrieben, interessieren Ennis und Robertson sich nicht für irgendwelche groß angelegten Verschwörungstheorien. Sie wollen nur die Superheldenmythologie als eine einzige große Lüge entlarven. Das gelingt ihnen bereits in den ersten Heften. Einige sich über mehrere Geschichten erstreckenden Einzelgeschichten, wie das Treiben der Supies bei ihrem Herogasm (dagegen ist Spring Break ein harmloser Kindergarten), bestätigten die Prämisse gelungen.
Trotzdem bleibt nach 72 Heften die Erkenntnis, dass „The Boys“ niemals das Potential seier Prämisse vollständig ausschöpft. Es bleibt bei der immer wieder nicht jugendfreien und oft sehr brutalen Demystifizierung des Superheldentums.
Nach dem Ende der Serie erschien 2020, begleitend zur Streaming-Adaption des Comics, der auf 8 Hefte beschränkte Nachschlag „Dear Becky“. Die deutsche Neuausgabe ist für Ende des Monats angekündigt.
–
Garth Ennis/Darick Robertson: The Boys – Vergeltung hat ihren Preis (Band 6)
(übersetzt von Bernd Kronsbein)
Panini, 2025
330 Seiten
17 Euro
–
Originalausgabe/enthält
Over the Hill with the Swords of a Thousand Men
The Boys (2006) # 60 – 65
November 2011 – April 2012
–
The Bloody Doors off
The Boys (2006) # 66 – 71
Mai 2012 – Oktober 2012
–
You found Me
The Boys (2006) # 72
November 2012
–
Hinweise
Wikipedia über „The Boys“ (deutsch, englisch) und über Garth Ennis (deutsch, englisch)
Meine Besprechung von Garth Ennis/John McCreas „Dicks – Band 1“ (Dicks # 1 – 4, 2013)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB