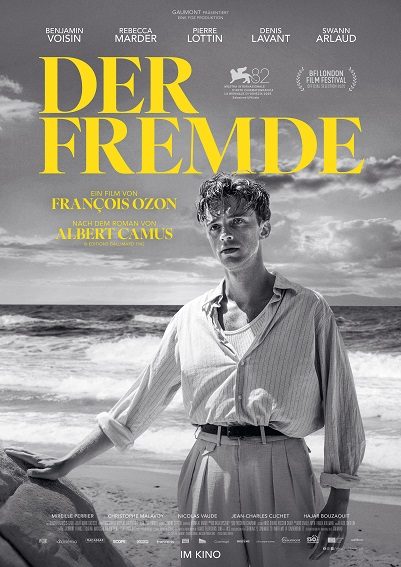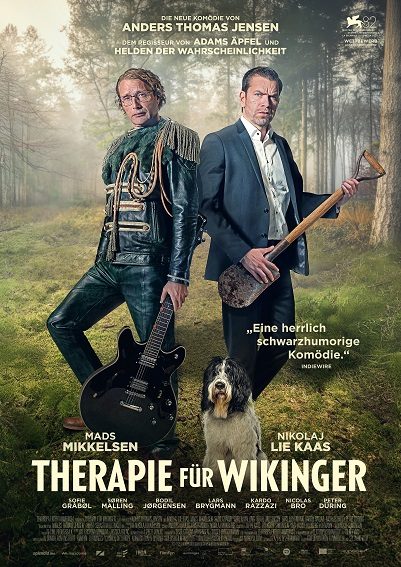Es ist schon wieder so weit: während die einen auf die Weihnachtsmärkte stürmen und über die Preise meckern (anstatt die fünfzig Euro für einmal Glühwein und Currywurst in einem guten Restaurant zu investieren) oder Silvesterböller kaufen (ohne über die Preisen zu meckern), sitzen die anderen über Jahresrückblicken und Bestenlisten. So auch ich.
Nach langem Nachdenken, räsonieren über nicht gesehene Filme und nicht gelesene Bücher, streichen, umstellen, wieder umstellen sehen meine Jahresbestenlisten für Kinofilme (und schon sind all die TV-Filme draußen) und Bücher (und schon konkurrieren Kriminalromane mit Sachbüchern und Comics) im Moment so aus (und würden in einigen Stunden wohl wieder anders aussehen):
Die zehn besten Filme des Jahres
Dieses Jahr war die Auswahl schwierig. Es gab viele gute, aber wenige großartige Filme, die mich sofort mitrissen und lange nachwirkten. Es gab sehr viele Filme, die großartig anfingen, irgendwann im zweiten Akt den Plot verloren und die Geschichte mit einem ärgerlichen dritten Akt beendeten; – falls sie mir nicht alle sagen wollten, dass das Leben sinnlos ist und der Zufall die herrschende Kraft im Universum ist.
Außerdem enttäuschten von vielen normalerweise zuverlässige Regisseuren die neuen Filmen.
Wenn ich mich auf zehn Filme beschränke, die 2025 im Kino anliefen (ch habe schon potentielle Anwärter für die 2026er Jahreslisten):
One Battle after another (schon während des Films sagte ich mir: der kommt auf meine Jahresbestenliste; – wenn ich eine Jahresbestenliste erstelle) (Das ist die ehrliche und angesichts der eintrudelnden Prognosen, Besten- und Nominierungslisten die absolut gefahrlose Wahl. Eigentlich jeder liebt diesen Film.)
Und jetzt, in keiner besonderen Reihenfolge, die Plätze 2 bis 10:
Blood & Sinners
Bugonia
Caught Stealing (Der Roman von Charlie Huston ist trotzdem besser.)
Die Farben der Zeit
Franz K.
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße (weil Wolfgang Beckers letzter Film, weil ein Berlin-Film – und weil er so gut in die Weihnachtszeit passt.)
Heldin
Juror # 2 (Clint Eastwoods letzter Film – bis zu seinem nächsten Film)
September 5 – The Day Terror went live
–
Die zehn schlechtesten Filme des Jahres
Oder: Was lief da schief?
Auch hier in alphabetischer Reihenfolge
The Alto Knights (sprachlos im Kino sitzend in einem Gangsterfilm von Barry Levinson mit Robert De Niro in der Hauptrolle, nach einem Drehbuch von Nicholas Pileggi)
Captain America: Brave New World (gutes Superheldenkino ist nur noch eine Erinnerung)
Conjuring 4 (absolut enttäuschender Abschluss einer gelungenen Horrorfilmreihe)
Eddington
Five Nights at Freddy’s 2
Honey don’t (50 Prozent Coen sind mindestens 50 Prozent zu wenig Coen)
Nosferatu (immerhin eine Gelegenheit, einige ältere Dracula-Verfilmungen wieder anzusehen)
Silent Night, Deadly Night
Tanz der Titanen
The Toxic Avenger (tja, nun, eine Entschuldigung, sich das Original mal wieder anzusehen)
–
ehrenwerte Nennung (weil ich ja nur Filme nehmen will, die im Kino liefen)
Play Dirty (Amazon Prime – Shane Black verfilmt Richard Stark. Wie kann das zu so einem unwitzigen Actionmurks führen, der nie Richard Starks Parker, sondern, mit allen zugedrückten Augen, Donald E. Westlakes Dortmunder an einem ganz schlechten Tag ist? „Play Dirty“ ist als Westlake/Stark-Verfilmug eine Vollkatastrophe. Dabei weiß und kann Black es besser.)
–
Filme, die besser als verdammt gut aussehende Screensaver mit Musik funktionieren
Avatar: Fire and Ash
Tron: Ares
Die zehn besten Bücher des Jahres
Wieder sind nur die Bücher qualifiziert, die dieses oder letztes Jahr erstmals auf Deutsch erschienen. Damit haben sich ältere oder noch nicht übersetzte Romane für diese Liste disqualifiziert. Und sie sollte weiblicher als meine letzte Bestenliste sein.
Also, mühelos quotiert:
Megan Abbott: Hüte dich vor der Frau
Jonathan Coe: Der Beweis meiner Unschuld
Frank Göhre: Sizilianische Nacht
Thomas Knüwer: Das Haus in dem Gudelia stirbt
Isabel Kreitz: Die letzte Einstellung
Jake Lamar: Viper’s Dream
Anna Mai: Broilerkomplott
Sara Paretsky: Wunder Punkt
Mercedes Rosende: Ursula fängt Feuer
Josef Schnelle: Der Mann, der das Kino liebte – Francois Truffaut und seine Filme
–
Einige Bücher, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diese Liste geschafft hätten, fehlen, weil ich aus verschiedenen Gründen viele ältere Romane (Ich sage nur „Momo“ und „Stiller“) las, dieses Jahre alle für den Glauser-Preis nominierten Romane und Debüts besprach, etliche Sachbücher lesen wollte und einige schlechte Bücher lesen musste.
Aber eine Liste der schlechtesten Bücher des Jahres ist unfair, weil da die vielen schlechten Bücher, die ich nicht zu Ende gelesen habe, fehlen würden.
Das gesagt lese ich gerade, wegen Park Chan-wooks „No other Choice“, die von Donald E. Westlake geschriebene Vorlage „The Ax“ (1997) und, nachdem ich die Verfilmung gesehen habe, steht Jordan Harpers „Die Rache der Polly McClusky“ (She rides shotgun, 2017) weit oben auf meiner Zu-Lesen-Liste.
–
Und was sind eure Tops und Flops?
Gefällt mir Wird geladen …



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB