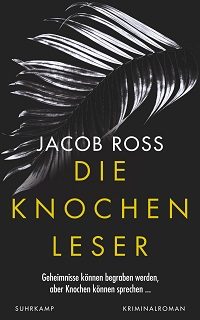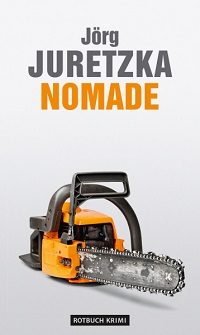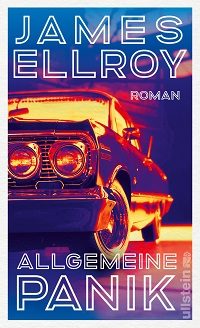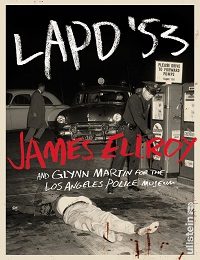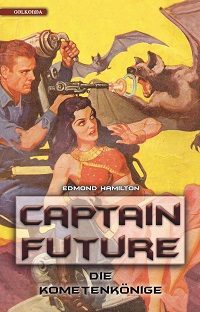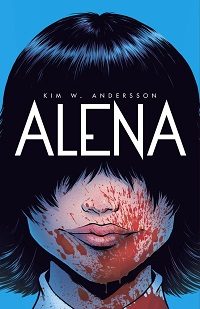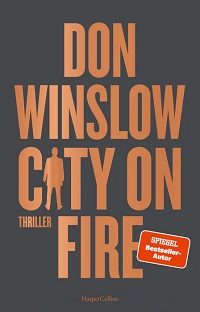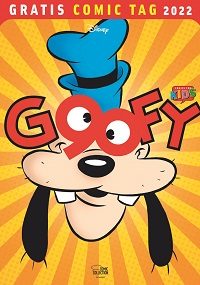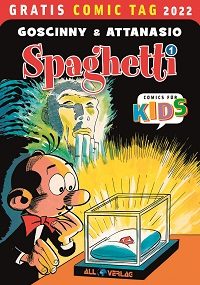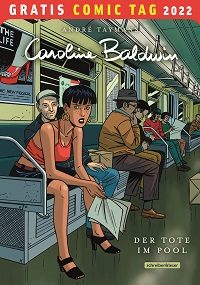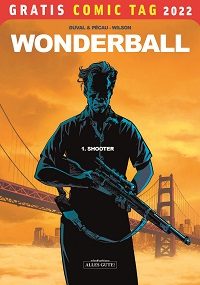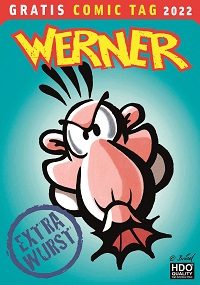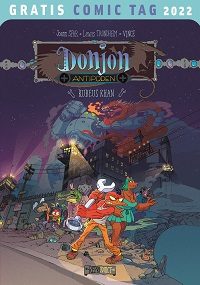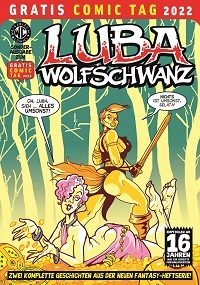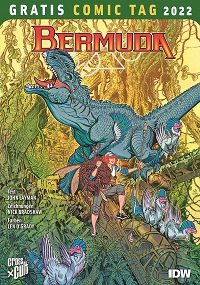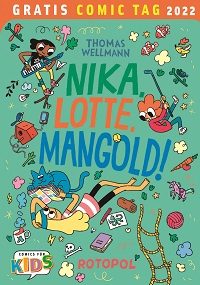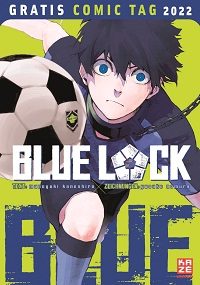Walter lädt mehrere alte Freunde, die er in der Schule und Universität kennen lernte und die sich teilweise von früher kennen, zu einer Woche in einem an einem See in Wisconsin gelegenem Haus ein. Es soll, so schreibt er ihnen, eine Woche mit seinen besten Freunden werden. Die Einladung angenommen haben ‚Künstler‘ Ryan Cane, ‚Autor‘ Norah Jakobs, ‚Comedian‘ David Daye, ‚Buchhalter‘ Molly Reynolds, ‚Wissenschaftler‘ Veronica Wright, ‚Reporter‘ Sam Nguyen, ‚Akupunkteur‘ Arturo Pérez, ‚Berater‘ Sarah Radnitz, ‚Arzt‘ Naya Radia und ‚Pianist‘ Rick MacEwan.
Als sie in dem Haus eintreffen, sind sie begeistert. Das Haus ist ein wahres Traumhaus, in dem fünfzehn Menschen bequem einige Tage miteinander verbringen können. Es gibt eine riesige Bibliothek und ein Kino. Der Blick auf den See ist malerisch. Und es gibt keine störenden Nachbarn.
Schon am ersten Abend wird aus dem Traumurlaub ein Alptraum. Sie erfahren aus den Nachrichten, dass sie die letzten Überlebenden sind. Dieses Glück verdanken sie Walter. Er ist einer der Außerirdischen, die gerade die gesamte Menschheit vernichten.
Aber ist das wirklich passiert? Immerhin haben die Gäste keinen Kontakt zur Außenwelt. Sie können nicht mit ihren Freunden telefonieren oder ihnen eine E-Mail schicken. Sie können das Gelände nicht verlassen. Es ist von einer unsichtbaren Wand umgeben. Jemand versorgt sie mit Lebensmitteln und anderen Dingen, die sie gerne hätten. Und es gibt Regeln und Zeichen, die ihnen anscheinend am ersten Tag verraten wurden. Allerdings dauert es einige Tage, bis sie das verstehen und versuchen, die Zeichen zu enträtseln.
Dazu gehören Skulpturen und ein anderes Haus, das anscheinend keinen Eingang hat. Trotzdem können sie es öffnen und sie werden von ‚Maler‘ Reginald Madison begrüßt. Er ist ein weiterer von Walters Freunden. Er behauptet, sie könnten die Welt noch retten.
„Das Haus am See – Band 1“ ist der vielversprechende Auftakt von Paninis neuer Reihe DC-Schocker, in der Horrorgeschichten erscheinen sollen. Sie ergänzt damit die von Joe Hill herausgegebene Reihe mit Horrorgeschichten. Gemeinsam ist beiden Reihen, dass es sich um neue, für sich selbst stehende Horrorgeschichten handelt. Wobei die von Autor James Tynion IV, Zeichner Àlvaro Martìnez Bueno (die auch die Schöpfer der Geschichte sind) und Kolorist Jordie Bellaire erfundene Geschichte über „Das Haus am See“ eine längere Geschichte, eine sogenannte Miniserie, ist, die bei Panini in zwei Bänden erscheint. Im jetzt erschienenem ersten Band sind die ersten sechs Hefte und damit die erste Hälfte der Miniserie gesammelt. Sie machen uns mit den elf Gästen bekannt. Mit einigen mehr, mit anderen weniger. Und wie sie mit der Frage umgehen, dass sie die letzten Menschen sind und in diesem Luxusgefängnis eingesperrt sind. Die Hefte bauen die Spannung auf. Sie präsentieren Rätsel, die im ersten Band noch nicht gelöst werden. Dazu gehört auch, dass wir nicht wissen, warum Walter diese Menschen auswählte und ob die Menschheit wirklich ausgelöscht wurde.
Das wird im zweiten Band geschehen. Aber, wie ein Blick in die USA zeigt, dürfte bis zur Veröffentlichung des zweiten, ebenfalls aus sechs Heften bestehenden, Sammelbands noch einige Monate vergehen. Dort ist kürzlich erst das neunte Heft erschienen.
–
James Tynion IV/Álvaro Martínez Bueno/Jordie Bellaire: Das Haus am See – Band 1
(übersetzt von Bernd Kronsbein)
Panini, 2022
196 Seiten
22 Euro (Softcover)
34 Euro (Hardcover, limitierte Auflage)
–
enthält
The Nice House on the Lake # 1- 6
DC Black Label, August 2021 – Januar 2022
–
Hinweise
Wikipedia über James Tynion IV und Jordie Bellaire
Meine Besprechung von Ollie Masters/Ming Dolye/Jordie Bellaires „The Kitchen“ (The Kitchen, 2015)



 Veröffentlicht von AxelB
Veröffentlicht von AxelB